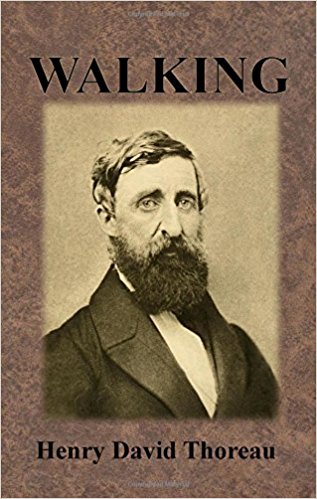Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vernunft und Erkenntnis
Humes Erkenntnislehre in „Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand“
Gefühl im Zusammenspiel von Erkenntnis und Handeln
Humes Lehre der Affekte
Analyse der Gefühle. Untersuchung der eigentlichen Antriebe in der menschlichen Natur, Dissertation über die Affekte
Das Verhältnis von Vernunft und Affekten
Das moralische Gefühl in Humes „Untersuchung über die Prinzipien der Moral“
Die Bedeutung der Methaethik
Das Verhältnis von Vernunft und Gefühl im moralischen Urteil
Das Problem des ethischen Relativismus
Sitte und Gefühl. Kulturrelativismus vs. Universalismus in „A Dialogue“
Das Prinzip der Sympathie
Gesellschaft und Gerechtigkeit
Gewohnheit und Sympathie als Natural operations of the mind
Schluss
Literaturverzeichnis
- Einleitung
Wie können wir erkennen, was moralisch ist? Spätestens seit dem Zeitalter der Aufklärung und ihrer Ablehnung rein metaphysischer oder religiöser Antworten auf diese Frage ergibt sich in der philosophischen Diskussion die Alternative zwischen Vernunft und Gefühl, sodass wir zur Spezifizierung fragen können: Liegt das Wesen der menschlichen Moral in der Vernunft oder im Gefühl? Mit Wesen ist hier dreierlei gemeint: der Ursprung, die Erkenntnismöglichkeit sowie die Handlungsmotivation. Kurz: Was erzeugt in uns das Verständnis für Moral, wie können wir erkennen, was gut und was böse ist, und wodurch werden wir dazu bewegt, moralisch gute Handlungen auszuführen und moralisch böse zu unterlassen?
Für die Problematik entscheidende Einsichten hat der schottische Philosoph David Hume im 18. Jahrhundert formuliert. Neben dem Earl of Shaftesbury, Francis Hutcheson und Adam Smith zählt Hume zu den Hauptvertretern der klassischen Gefühlsethik, die sich aus ihrer empiristischen Epistemologie ergeben. Die Fokussierung auf Beobachtung und Experiment bringt auch in der Ethik eine Konzentration auf den Menschen und seine Psyche mit sich. Ethisches Handeln und Urteilen sollen nun, im Gegensatz zu transzendierenden Erklärungen wie denen Platons, allein aus der menschlichen Natur erklärt werden. In Abgrenzung zu Shaftesbury und Hutcheson, die einen moralischen Sinn (moral sense) annahmen, der nicht nur zu moralischem Handeln motiviert, sondern Gut und Böse auch erkennen kann, formuliert Hume seine Theorie des moralischen Gefühls. Dieses sei in erster Linie für unser Verständnis von Moral verantwortlich.
In meiner Arbeit gehe ich der Frage nach, wie Hume seine Gefühlsethik begründet. Dazu wird im ersten Teil auf die empirische Erkenntnistheorie in Humes „Untersuchung über den menschlichen Verstand” (1748) zurückgegriffen, da in ihr epistemologische und psychologische Grundlagen für das Verständnis der menschlichen Seele gelegt werden. Nur durch den Aufweis der Rolle, die der Erfahrung im Erkenntnisprozess zukommt, kann ein rechtes Verständnis der Hume’schen Gefühlsethik erlangt werden. Im zweiten Teil wird dann auf die spezifische Funktion der Gefühle (passions) im Erkenntnisprozess und beim menschlichen Handeln eingegangen. Wenn sich Moralität aus Gefühl ableiten lassen soll, muss geklärt werden, wie die Gefühle strukturiert sind, wie sie unseren Willen beeinflussen und welcher Erkenntniswert ihnen zukommt. Im dritten Teil schließlich wird erörtert, wie aus unseren Gefühlen ein Verständnis von Moral entsteht und welche besondere Rolle Hume dabei dem Mitgefühl zukommen lässt. Auch ist genauer zu klären, welche Funktion der Vernunft bei Hume – trotz aller Subordination unter die Gefühle – im moralischen Urteil zukommt.
Es wird zu erörtern sein, inwiefern aus David Humes Konzeption der Gefühlsethik ein ethischer Skeptizismus erwächst, und wie dieser sich zu der Gefahr eines Agnostizismus verhält, der in einen Relativismus mündet. Wenn alles sich nur am subjektiven Gefühl orientiert, welche Möglichkeiten der Vergleichbarkeit moralischer Urteile ergeben sich dann noch? Wie antwortet Hume auf das Problem, dass die Berufung auf das Gefühl als Führerin in ethischen Belangen einen Subjektivismus nach sich zieht, der im extremen Fall zur Haltung der Indifferenz gegenüber moralischen Belangen führen kann?
2. Vernunft und Erkenntnis
2.1 Humes Erkenntnislehre in der „Untersuchung über den menschlichen Verstand”
Um zu ergründen, welche Rolle der Vernunft in David Humes Moralphilosophie zukommt, ist es notwendig, die Grundlinien der von ihm formulierten Erkenntnistheorie nachzuvollziehen. Als Empirist gesteht Hume der Vernunft1 wie zu erwarten eine untergeordnete Rolle für den Erkenntnisprozess zu. Gleichwohl erhält sie, wie zu zeigen sein wird, sowohl epistemologisch als auch ethisch eine nicht zu unterschätzende Funktion.
In seiner „Untersuchung über den menschlichen Verstand” (1748) legt Hume dar, wie der Prozess unserer Erkenntnis abläuft und beginnt zu diesem Zweck mit der Katalogisierung der Inhalte des Geistes, den Perzeptionen (perceptions). Der Begriff „Perzeptionen“ weist bereits darauf hin, dass sich nach Humes Ansicht nichts im Geist befindet, was nicht vorher durch die Sinne aufgenommen wurde. Die Perzeptionen des Geistes nun werden von Hume in zwei Arten unterteilt. Zum einen finden wir im Geist das durch äußere und innere Wahrnehmung gegenwärtig und tatsächlich Gegebene. Er nennt dies “impression“ (Eindruck). Dies umfasst alle lebhaften Perzeptionen, wie hören, sehen, fühlen, lieben, hassen, begehren oder wollen2. Die Aufzählung zeigt, dass die Eindrücke von eindringlicher und deutlicher Natur sind. Andererseits finden wir im Geist auch schwächere Perzeptionen: durch Erinnerung und Phantasie hervorgebrachte Nachbilder der Eindrücke bzw. bloße Kopien der Eindrücke. Diese nennt er “ideas“ (Vorstellungen).
Das Unterscheidungskriterium liegt also in der Lebendigkeit oder Unmittelbarkeit beider Perzeptionen. So sind die Eindrücke lebendiger, schärfer und stärker als die Vorstellungen, die weniger lebhaft, blasser und schwächer sind: „Ein Mensch in einem Zornausbruch wird in gänzlich anderer Weise ergriffen als jemand, der nur an diese Gemütserregung denkt.“3
Aus der Reihenfolge wird deutlich, dass das Fundament unserer Erkenntnis in den Eindrücken besteht; ihnen entstammen alle weiteren Vorstellungen:
„Wenn wir unsere Gedanken oder Vorstellungen – seien sie auch noch so kompliziert und erhaben – analysieren, stellen wir stets fest, daß sie sich zu solchen einfachen Vorstellungen auflösen, die einem vorherigem Gefühl oder einer Empfindung nachgebildet sind.“4
Daraus folgt, dass alle Vorstellungen des Geistes von den Eindrücken abhängig sind; folglich kann sich der Geist auch nichts vorstellen, was nicht vorher in irgendeiner Form durch den inneren oder den äußeren Sinn erfahren wurde. Hume folgt hier Gassendis Tabula-Rasa-These, die von John Locke folgendermaßen formuliert wird: „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war.“5
„Ein Blinder kann sich keinen Begriff von Farben […] machen. Man stelle […] den fehlenden Sinn wieder her, und indem man diesen neuen Zugang für seine Wahrnehmung öffnet, öffnet man auch einen Zugang für die Vorstellung […].“6
Da nun die wenigsten Inhalte unseres Geistes aus lebhaften Eindrücken bestehen, ist zu fragen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sich die Eindrücke und Vorstellungen zu komplexeren Vorstellungen verknüpfen. Wie verfährt der Mensch als wahrnehmendes Wesen mit den Eindrücken, die er erfährt, und mit denen ihnen korrespondierenden Vorstellungen?
Der Mensch nutzt hierzu einerseits sein Gedächtnis, das uns vergangene Eindrücke bewusst werden lässt, und andererseits seine Einbildungskraft, die die Eindrücke als Vorstellungen neu ordnet. Während das Gedächtnis, die Erinnerung, zu Änderungen unfähig ist, vermag die Einbildungskraft (imagination) Eindrücke neuassoziieren. Hier findet Hume folgende drei Prinzipien:
Das Prinzip der Ähnlichkeit (Resemblance)
Das Prinzip der raum-zeitlichen Berührung (Contiguity)
Das Prinzip der Ursache oder Wirkung (Cause or Effect)
Das Prinzip der Ähnlichkeit tritt in Kraft, wenn wir Gemeinsamkeiten in der sinnlichen Form zweier Eindrücke ausmachen, so z.B., wenn wir ein Portrait mit dem Modell vergleichen. Das Prinzip der raum-zeitlichen Berührung liegt zugrunde, wenn Eindrücke entweder räumlich oder zeitlich nah miteinander verbunden sind (der Anblick eines Portraits und die Erinnerung an andere, im Museum neben ihm hängende Portraits). Zu guter Letzt wirkt das Prinzip der Ursache und Wirkung, wenn wir z.B. an eine Wunde und den ihr folgenden Schmerz denken.
Für die Erkenntnistheorie von Belang ist natürlich die Frage, auf welche Weise wir feststellen können, ob die Bewusstseinsinhalte mit der Realität übereinstimmen, ob wir also Wahrheit oder Gewissheit erlangen können. Zu diesem Zweck teilt Hume die Gegenstände menschlichen Denkens und Forschens in zwei Gruppen auf: Wissenschaften, die sich mit der Verknüpfung von Vorstellungen (relations of ideas) befassen, wie z.B. die Mathematik oder die Logik, und solche, die sich mit Tatsachen (matters of fact) befassen. In der Mathematik wird Wissen a priori, durch bloße Denktätigkeit, unabhängig von der Außenwelt und nach dem Prinzip der Deduktion erfasst. In den Tatsachenwissenschaften können nur solche Erkenntnisse Wahrheitswert beanspruchen, die sich unmittelbar auf Eindrücke bzw. Erfahrung zurückführen lassen. Alle Vernunfterwägungen, die Tatsachen betreffen, beruhen auf der Beziehung von Ursache und Wirkung. Für deren Erkenntnis benötigen wir an erster Stelle Erfahrung.7 Theoretisches Wissen können die Erfahrungswissenschaften nur über den Induktionsschluss erlangen, dessen Methode der Verallgemeinerung von Einzelsätzen allerdings im Hume’schen Erkenntnismodell durch keine Schlussregel gerechtfertigt werden kann.
Grund dafür ist die sich auch gegen den Rationalismus positionierende, bedeutende Erkenntnis Humes vom Erfahrungsursprung der Kausalität. Für Hume bedarf es keiner Begründung, dass die Kausalanalyse den Kern der Erkenntnistheorie ausmacht, die auf die Analyse der menschlichen Natur abzielt.
„’Tis evident, that all reasoning concerning matter of fact are founded on the relation of cause and effect, and that we can never infer the existence of one object from another, unless they be connected together, either mediately or immediately.”8
Die Beziehung von Ursache und Wirkung ist nicht durch Vernunft (a priori), sondern durch Erfahrung (a posteriori) zu entdecken.
„Wenn man fragt: Von welcher Art sind alle unsere Gedankengänge, die sich mit Tatsachen befassen?, dann scheint die richtige Antwort zu sein, dass sie auf der Beziehung von Ursache und Wirkung beruhen. Fragt man wiederum: Welches ist die Grundlage all unserer Gedankengänge und Schlussfolgerungen, die sich mit dieser Beziehung befassen?, so kann man in einem Wort antworten: Erfahrung.“9
Dass zwei Ereignisse in einem Kausalzusammenhang stehen, ergibt sich nicht aus rein rationalem Nachdenken, da keine Eigenschaft an Ereignis A denknotwendig nahelegt, dass aus ihr Ereignis B folgt: „Adam […] hätte von der Flüssigkeit und Durchsichtigkeit des Wassers [ohne Erfahrung] nicht darauf schließen können, daß es ihn erstickt […].“10
Für Kant bewies Hume „unwidersprechlich“:
„[…]daß es der Vernunft gänzlich unmöglich sei, a priori und aus Begriffen eine solche Verbindung zu denken, denn diese enthält Notwendigkeit; es ist aber gar nicht abzusehen, wie darum, weil Etwas ist, etwas anderes notwendiger Weise auch sein müsse, und wie sich also der Begriff von einer solchen Verknüpfung a priori einführen lasse.“11
Bezüglich der Wahrheit bzw. Gewissheit der Bewusstseinsinhalte zeigt sich, dass sich bloße Vorstellungsverknüpfungen durch reines Denken als richtig oder falsch erweisen. Sie sind, in Kantischer Terminologie ausgedrückt, analytisch und a priori wahr (oder falsch). Sätze intuitiver oder demonstrativer Gewissheit, wie z.B. der Satz des Pythagoras, behalten für immer ihre Gewissheit und Evidenz; ihre Wahrheit wird durch Widerspruch belegt. Tatsachen hingegen müssen durch Erfahrungsschlüsse belegt werden, d.h., dass auch ihr Gegenteil rein theoretisch möglich ist. Während wir die Richtigkeit des Satzes des Pythagoras allein durch logischen Widerspruch belegen können, ist die Aussage, dass diese Rose rot ist, genauso widerspruchsfrei möglich wie die Aussage, dass sie nicht rot ist – es handelt sich, wieder Kantisch gesprochen, um ein synthetisches Urteil a posteriori. Der Satz des Pythagoras jedoch ist nicht gleichzeitig mit seinem Widerspruch denkbar, eine Tatsache allerdings schon. Somit können auf Erfahrungsschlüssen beruhende Wissenschaften, also nicht Mathematik und Logik, Humes Ansicht nach immer nur wahrscheinliche und nie ganz gewisse Aussagen enthalten.
Um dies zu verdeutlichen, führt Hume, ähnlich wie Leibniz, die Unterscheidung zwischen Erkenntnis (knowledge) und Wahrscheinlichkeit (probability) ein, die sich am Grad der Gewissheit unseres Wissens orientieren: Erkenntnis bezieht sich auf Relationen von Ideen, Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf unser Wissen über die Beziehungen zwischen Tatsachen. Dieses Wissen übersteigt niemals einen gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit, während jenes intuitiv oder demonstrativ erkannt werden kann.
Der Vergleich zu Leibniz‘ Unterscheidung zwischen „Vernunftwahrheiten“ (les vérités de Raisonnement), die analytisch und notwendig gelten, und „Tatsachenwahrheiten“ (les vérités de Fait)12, deren Gegenteil immer möglich ist, verdeutlicht Humes empirischen Ansatz. Im Gegensatz zu Leibniz‘ Position beruht unsere apriorische Erkenntnis auf den Relationen von Ideen, die wiederum auf Sinneswahrnehmungen beruhen, und nicht auf selbstevidenten Axiomen.
Worin besteht nun die Grundlage, auf der wir Erfahrungsschlüsse ziehen? Hume geht es um das grundlegende Prinzip, durch das wir für Ereignisse aus der Vergangenheit, die wir mit einer Folge verknüpft haben, auch in Zukunft Wirkungen erwarten. Denn
„nicht die Vernunft [veranlasst uns] zur Annahme der Ähnlichkeit von Vergangenheit und Zukunft und zur Erwartung gleichartiger Wirkungen aus – dem Anschein nach gleichartigen Ursachen.“13
Unter Ursache verstehen wir dabei einen „Gegenstand, der einen anderen zur Folge hat, wobei alle dem ersten ähnlichen Gegenstände solche, die dem zweiten ähnlich sind, zur Folge haben.“14 Humes Antwort besteht in dem Prinzip der Gewohnheit (custom) oder der Übung (habit), das in der Natur des Menschen liegt und all unsere Erfahrungsschlüsse über Ursache und Wirkung bestimmt: „Wir stellen fest, daß wir gemäß einem konstanten Zusammenhang zweier Gegenstände – z.B. Hitze und Feuer […] – einzig durch Gewohnheit bestimmt werden, daß eine beim Auftreten des anderen zu erwarten.“15 Erfahrungsschlüsse sind ausschließlich Folgen der Gewohnheit. Nur durch die Beobachtung der Gewohnheit zweier Objekte, sich in einem bestimmten Verhältnis zueinander zu verhalten, schließen wir auf Kausalität. Gewohnheit erzeugt in uns eine Erwartungshaltung und damit eine subjektive Zwangsvorstellung, die wir als objektive Notwendigkeit deuten.
Die Nützlichkeit einer Erfahrung wird allein durch dieses Prinzip bewirkt, da es uns erlaubt, für die Zukunft einen ähnlichen Ablauf eines Prozesses zu erwarten, das heißt, eine ähnliche Verknüpfung zweier Ereignisse, wie wir sie in der Vergangenheit beobachtet haben.16 Warum vertrauen wir dem Prinzip, dass gleiche Ursachen unter gleichen Bedingungen gleiche Wirkungen hervorrufen? Wenn wir ähnliche Ursachen mit ähnlichen Wirkungen wiederholt verbunden sehen (conjoinment), führt uns die Gewohnheit zur Verknüpfung beider (customary conjunction). Unser Geist ist, wenn er in der Vergangenheit die wiederholte Erfahrung gemacht hat, dass auf eine Flamme Hitze folgt, dazu genötigt, beim erneuten Beobachten einer Flamme Hitze zu erwarten.
Es ist dies aber nur ein Glaube (belief) an die kausale, in den Dingen selbst liegende Verknüpfung von Flamme und Hitze; gleichzeitig ist dieser Glaube Hume zufolge ein notwendiges Ergebnis unseres affektiven und instinktiven Erkenntnisvorgangs. Wir können in dieser Situation nicht umhin, an die Kausalität zu glauben, ebenso wenig, wie wir es verhindern können, Liebe zu empfinden, wenn wir Wohltaten empfangen, oder Hass, wenn man uns Leid zufügt. Diese Vorgänge sind also nicht das Ergebnis von Denkakten, und ebenso ist auch der Glaube an die Kausalität instinktiver Natur.17 Wir schließen mechanisch, d. h. ohne jegliches Nachdenken und ganz von alleine, vom Bekannten auf das noch Unbekannte, was uns wiederum Erkenntnis und praktisches Handeln erst erlaubt: „So ist die Gewohnheit die große Führerin im menschlichen Leben“18, nicht die Vernunft.
Die Grundlage all unserer Schlüsse aus der Erfahrung ist also eine Art Instinkt, eine natürliche Operation der Vernunft (natural operation of the mind), der sich in einer gewohnheitsmäßigen Verknüpfung ausdrückt und den Glauben an die Gleichförmigkeit der Natur zur Bedingung hat. Menschen glauben auch ohne eine empirische oder rationale Rechtfertigung an das Prinzip der Kausalität; dieser Glaube ist instinktiv und damit psychologischer, nicht logischer Natur19 und auch der Grund dafür, dass der Induktionsschluss nur ein auf der Gewohnheit, aus den bisherigen Erfahrungen auf die Zukunft zu schließen, basierendes Verfahren ist, dass keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann.
Dieser Instinkt ist die Voraussetzung für Erkennen und Handeln, da wir ohne ihn nichts lernen könnten: jede Einzelerfahrung bliebe monolithisch für sich stehen, ohne dass wir aus ihr Regelmäßigkeiten ableiten und Prognosen machen könnten, die uns zu einem alltäglichen Leben, aber auch zu wissenschaftlicher Erkenntnis erst befähigen. Ohne diese Regelmäßigkeiten erschiene uns die Welt als chaotisch und unberechenbar.
Humes Erfahrungsschluss ist also vierstufig strukturiert:
Anschaulich gegebenes Ding
Beispiel: Eine Person betritt einen Raum, der durch einen Ofen beheizt ist und verspürt das Gefühl von Wärme.
Assoziation/ Erfahrung des Subjekts mit dem gegebenen Ding
(Diese Erfahrungssedimente können auch durch den Austausch mit anderen entstehen.)
Beispiel: Die Person hat die Erfahrung der Simultanität der Anwesenheit von Feuer zum Gefühl von Wärme gemacht.
Annahme der Gleichförmigkeit der Natur (natural operation of the mind)
Beispiel: Die Person schließt gewohnheitsmäßig aus der Wärme auf die verbrennende Hitze des Ofens.
Glaube (belief)
Beispiel: Die Person glaubt oder hält es auch dieses Mal für wahr, dass die Wärme im Raum der verbrennenden Hitze des Ofens entstammt.
Hume unterscheidet den Begriff des Glaubens (belief) in einem weiteren Abschnitt seiner Untersuchung von dem der Fiktion. Der Glaube wird nach Hume unserem Geist in Form eines Gefühls bewusst (felt by the mind). Der Unterschied liegt dabei darin, wie wir die Vorstellung erleben: „Der Glaube ist nichts weiter als die Vorstellung eines Gegenstandes, die lebhafter, lebendiger, stärker, fester und beständiger ist, als was die Einbildungskraft allein erreichen kann.“20 Der Glaube als „ein geistiges Erlebnis […], das die Vorstellungen der Urteilskraft von den Fiktionen der Einbildungskraft unterscheidet“21, lässt den Vorstellungen ein stärkeres Gewicht zukommen und verleiht ihnen eine höhere Bedeutsamkeit. Daraus folgt, dass er einen direkten Einfluss auf unser Handeln hat, was von der Fiktion, z. B. der Vorstellung an einen goldenen Berg, nicht behauptet werden kann.22 Im Traktat betont Hume, dass der Glaube uns über das unmittelbare Zeugnis unserer Sinne hinausführt:
„Weil also der Glaube nichts anderes macht als die Art und Weise zu verändern, in der wir irgendein Objekt wahrnehmen, kann er unseren Ideen nur eine zusätzliche Kraft und Lebendigkeit verleihen. Eine Meinung oder der Glaube kann daher am genauesten definiert werden als eine lebendige Idee, die bezogen ist auf oder assoziiert ist mit einem gegenwärtigen Eindruck.“23
Im siebten Abschnitt seiner Untersuchung spricht Hume über die Grenzen unseres Verstandes. Dabei betont er, dass wir „[…] einzig aus Erfahrung die häufige Verbindung (constant conjunction between the cause and effect) von Gegenständen kennenlernen, ohne freilich je imstande zu sein, so etwas wie Verknüpfung (connection) zwischen ihnen zu begreifen.“24. Um seine These zu begründen, untersucht er drei Beziehungen von Kausalität (Prinzip von Ursache und Wirkung):
Körper – Körper – Beziehung (z.B. der Zusammenstoß zweier Billardkugeln)
Geist – Körper – Beziehung (z.B. das Heben eines Arms)
[Geist – Geist – Beziehung (Gottes Wille)]
In jeder dieser drei Beziehungen vermutet unser Geist eine Art Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Nach den Prinzipien der Assoziation werden wir subjektiv genötigt, bestimmte Kausalbeziehungen zwischen den Dingen herzustellen, sobald wir entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Doch dieser Zusammenhang selber, als eine Kraft etwa, ist nicht erfahrbar. Unseren Sinnen bleibt die Verknüpfung von Ursache und Wirkung unzugänglich; Kausalität ist eine reine Vermutung. Wir sehen keine Kraft, sondern nur die vermeintliche Wirkung nach der Ursache. Selbst die Betrachtung unseres Willens zeigt uns keine Kraft, die es diesem ermöglichen würde, Dinge mit Notwendigkeit hervorzubringen oder zu bewirken. Das einzige, was wir laut Hume beobachten können, ist die Aufeinanderfolge zweier Ereignisse, doch die Bindung untereinander, die wirkliche Verknüpfung zwischen ihnen können wir niemals erkennen; „sie scheinen verbunden (conjoined), doch nie verknüpft (connected).“25
„Die Verknüpfung, die wir im Geiste erfahren (feel), dieser gewohnheitsmäßige Übergang der Einbildungskraft von einem Gegenstand zu seiner üblichen Begleiterscheinung, ist die Empfindung oder der Eindruck, woraus wir die Vorstellung der Kraft oder des notwendigen Zusammenhangs bilden.“26
Auch der Satz vom Grund, der schon in Aristoteles‘ Metaphysik als Grundlage des Erkennens formuliert wird (wir erkennen ein Ding nur dann, wenn wir seine erste Ursache erkannt haben), ist für Hume kein aus der reinen Vernunft sich ergebender Satz. Wir könnten uns bei jedem Ding auch vorstellen, dass es keine Ursache hat.
Wir stellen uns die Existenz von kausalen Zusammenhängen also nur vor. Nachdem wir oft das Auftreten eines Ereignispaares erlebt haben (Hume erklärt dies am Beispiel der Kollision von Billardkugeln), ohne mehr als ihre Verbindung herstellen zu können, nehmen wir sie irgendwann in unserer Vorstellung als miteinander verbunden wahr. Der kausale Zusammenhang zwischen den mit dem Gefühl einer Verbindung verbundenen Ereignissen ist eine konstruktive Leistung des beobachtenden Subjekts und nichts anderes als eine Wirkung der Gewohnheit, nicht der Vernunft. Aber weil die Phantasie auch die „unbegrenzte Macht hat, die Vorstellungen all der vielfältigen Formen, die sie dichtet und ansieht“, zu vermischen, zusammenzusetzen, zu trennen und zu teilen, steht Hume vor dem Problem, wie man ihre gewünschten Produkte (kausale Zusammenhänge) von den unerwünschten (Geisterglauben, „dunkelste und ungewisseste Vorstellungen von Metaphysik“ wie Macht, Kraft, Energie) sinnvoll unterscheidet. Da ihm dies in der Abhandlung nicht gelingt, verkündet er verzweifelt, dass er im Begriff ist, jeden Glauben und jedes Vertrauen in unsere Schlussfolgerungen wegzuwerfen und keine Meinung als möglich und wahrscheinlicher als jede andere zu betrachten.
Ob ein Ereignis tatsächlich die Ursache eines anderen ist, dem wir durch unsere Gewohnheit und den Glauben an die Gleichförmigkeit der Natur den Charakter der Wirkung zusprechen, ist für Hume also nicht wirklich zu sagen, erkenntnistheoretisch aber auch nachrangig. Humes „skeptischer Realismus“ gibt zwar zu, dass Kausalität nicht wirklich erkennbar ist, nimmt aber doch an, dass es in den Dingen reale Kräfte gibt, die andere Dinge verursachen. Dies ergibt sich auch aus der Annahme, dass eine Welt ohne regelmäßige Abfolge von Eindrücken und Ideen keine Gewohnheit ermöglichen würde, und damit auch keinen Glauben an die Gleichförmigkeit der Natur. In den Dingen selbst scheint es also Regelmäßigkeiten zu geben, die die Erfahrung der Gewohnheit überhaupt erst ermöglichen.
Die „prästabilierte Harmonie zwischen dem Lauf der Natur und unserer Ideen“27, von der Hume in diesem Zusammenhang spricht, ist jedoch kein metaphysisches Prinzip, wie Leibniz mit seiner harmonia praestabilitia annimmt, sondern laut Hume durch das Prinzip der Gewohnheit hervorgebracht: „Wie uns die Natur den Gebrauch unserer Glieder gelehrt hat, ohne uns von den Muskeln und Nerven, wodurch sie bewegt werden, Kenntnis zu geben, so hat die Natur uns einen Instinkt eingepflanzt, der unser Denken in eine Richtung führt, die dem Ablauf der zwischen den Außendingen waltenden Verhältnisse entspricht“.28
Für Hume ist diese Gewohnheit so wichtig, weil sie uns über das unmittelbare Zeugnis unserer Sinne hinausführt29; ohne die Relation von Ursache und Wirkung hätten wir nur zur Verfügung, was unseren Sinnen unmittelbar gegeben ist oder was in unserem Geist als Erinnerung gegenwärtig ist. Erst durch die Annahme von Kausalität fügen sich für uns die einzelnen Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen, zu einem Ganzen, einer intelligiblen Welt, zusammen; durch sie sind unsere Einzelerfahrungen „zusammenzementiert.“
Im Gegensatz zu Leibniz‘ Behauptung, wir könnten eine vernunftgemäße Erkenntnis von Kausalität haben, die in der Natur der Dinge (causa efficiens oder finalis) liegt, stellt Hume fest, dass wir die wahre Ursache eines Dings oder Ereignisses nicht a priori erkennen können. Es gibt „nichts in irgendeinem Objekt, an sich selbst betrachtet, das uns einen Grund für einen Schluss geben würde, der über dieses Objekt hinausführt.“30 Hume verdeutlicht das anhand des Beispiels eines Menschen, der als Erwachsener im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten geboren wird, jedoch ohne jegliche Erfahrungen gemacht zu haben. Bei einer ersten Erfahrung könnte er nicht prognostizieren, was nun geschehen wird, denn: „Beim ersten Anblick eines Gegenstandes lässt sich niemals vermuten, welche Wirkung er haben wird.“31 Die Ursache enthält, für sich betrachtet, keinerlei Merkmale, die auf eine Wirkung schließen ließen.
Auch im Vergleich zu Kant, für den der Satz, dass alle Veränderungen in der Natur „nach dem Gesetze der Verknüpfung von Ursache und Wirkung“32 geschehen, ein synthetisches Urteil a priori ist, ist er für Hume, bei dem es für diese Kategorie keine Entsprechung gibt, nur ein synthetisches Urteil a posteriori, da er auf dem Instinkt und der Gewohnheit beruht; ihm kommt also nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu.
Hume zufolge ist der Mensch also ganz und gar einen „Sinnenwesen“. Wahrnehmungen sind die Grundlage allen Erkennens, und das Gefühl des Glaubens, dass gewohnheitsmäßig.hintereinander auftretende Dinge kausal verknüpft sind, ermöglichen Wissen und Handeln. Folglich ist alle Wahrscheinlichkeitserkenntnis nichts anderes als eine Art von Empfindung. Nicht allein in der Dichtung und in der Musik müssen wir unserem Geschmack und unserem Gefühl folgen, sondern in gleicher Weise in der Philosophie. Wenn ich hinsichtlich eines Prinzips überzeugt bin, ist es allein eine Idee, die mich stärker beeindruckt. Wenn ich einer Reihe von Argumenten den Vorzug vor einer anderen gebe, mache ich nichts anderes, als aufgrund meines Fühlens über die Überlegenheit ihres Einflusses zu entscheiden.33 Auch die Vernunft ist „nichts als ein wunderbarer und unfasslicher Instinkt in unseren Seelen, der uns entlang einer gewissen Reihe von Ideen leitet und sie, gemäß ihrer besonderen Situationen und Beziehungen, mit besonderen Eigenschaften ausstattet.“34 Das bedeutet, dass sie nicht mehr als diejenige Fähigkeit angesehen werden kann, die die differentia specifica zum Tier bildet. Auch das Tier orientiert sich sinnenhaft an der Natur und schließt von vergangenen Ereignissen auf künftige; auch das Tier glaubt offensichtlich an eine Gleichförmigkeit der Natur. Das wirft für unsere Zwecke natürlich die Frage auf, ob der Mensch sich in moralischer Hinsicht vom Tier unterscheidet; falls ja, dann müsste für das moralische Urteil eine Instanz maßgeblich sein, über die das „nicht-menschliche Tier“ nicht verfügt: die Vernunft.35
In der Philosophiegeschichte wurde die These vom Ursprung der Moral in der menschlichen Vernunft seit Platon immer wieder prominent vertreten, so etwa bei Descartes und später bei Kant, weswegen es als geistesgeschichtliche Revolution angesehen wird, wenn Empiristen wie Hume, aber auch Shaftesbury und Hutcheson, nun nach einer anderen Herkunft für die Moral suchen. Für die Zeitgenossen, aber auch für uns heute, steht auch die Sonderstellung des Menschen als allein vernunft- und moralbegabtes Wesen auf dem Spiel.
Aus dem über die Rolle der Empirie Gesagten ergibt sich, dass Hume der Vernunft auch im Bereich des moralischen Urteils keine eminente Rolle zusprechen kann. Seine Epistemologie, Anthropologie und Metaethik würden nicht zueinander passen, wenn er im Bereich des Erkennens die Vernunft der inneren und äußeren Wahrnehmung unterordnete, ihr im Bereich der Morallehre und -psychologie jedoch den Primat einräumte. Um nun aber zu begründen, inwiefern auch dort das Gefühl die Hauptinstanz sein kann, müssen wir Humes Lehre vom Gefühl genauer beleuchten.
Fazit
Charakteristisches Merkmal von Humes Philosophie ist der Skeptizismus, wie sich auch und vor allem in seiner Erkenntnistheorie zeigt. Die Relativierung der Macht der Vernunft für die Erkenntnis geht einher mit der Relativierung ihrer Rolle in der Ethik. Der Skeptizismus sowie die empirische Methode, die psychischen Vorgänge des Menschen beim Erkennen und Urteilen zu beobachten, führen zur Suche nach einer anderen Quelle von Moralität, sowohl was die Unterscheidung von Gut und Böse als auch die Handlungsmotivation angeht.
3. Gefühl im Zusammenspiel von Erkenntnis und Handeln
3.1 Von der theoretischen Philosophie zur praktischen Philosophie Humes
Humes geistiges Schaffen verschiebt sich in seinem zweiten Buch des Traktats vom theoretischen zum praktischen Gebiet hin. Im Gegensatz zum ersten Buch, in dem er den Fokus auf die Analyse der Erkenntnisfähigkeiten, der Vorstellungen und deren Verknüpfungsprinzipien legt, konzentriert er sich nun auf die Untersuchung der Eindrücke. Hierbei interessieren ihn insbesondere die inneren Sinneseindrücke (impression of reflexions), wie Freude, Schmerz, Kummer, Liebe, Hass, Demut oder Stolz.36 Die Frage nach ihrer Entstehung und ihrer Abhängigkeit zueinander bilden dabei den Kern seiner Untersuchung.
Seine spätere Moralphilosophie basiert auf seiner im zweiten Buch des Traktats empirisch-psychologischen Einzelforschung und befindet sich im Gegensatz zu seiner theoretischen Lehre auf dem Grenzgebiet zwischen philosophischer Ethik einerseits und praktisch-empirischer Spezialforschung und Lebensweisheit andererseits.
3.2 Humes Lehre von den Affekten (Of the Passions)
Im Gegensatz zu den zahlreichen und umfassenden Monographien zu Humes theoretischer sowie Moralphilosophie, findet seine Affektenlehre (TMN, II, „Of passions“) keine gleichwertige Behandlung bzw. Darstellung. Während Buch I und III des Traktats später erneut von Hume, in publikumsfreundlicherer Neufassung veröffentlicht wurden, (Enquiry concerning Human Understanding, 1748; Enquiry concerning the Principles of Morals, 1751), behandelte er das zweite Buch lediglich in einer stark gekürzten Version, „A Dissertation on the Passions“, die neben drei weiteren Abhandlungen („The Natural History of Religion, „Of Tragedy“ und „Some Considerations previous to Geometry & Natural Philosophy“) 1757 unter dem Titel „Four Dissertations“ publiziert wurde. Die Lehre von den von den Affekten ist der früheren Periode von Humes Denken zuzuordnen. Die zeitliche Nähe zwischen dem zweiten Teil und der theoretischen Untersuchung über den menschlichen Verstand (TMN, I, „Of the Understanding“) hatte zur Folge, dass die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen und Grundlagen hier (TMN, II, „Of Passions“) verhältnismäßig stärker nachwirkten als in der später verfassten Ethik (TMN III, „Of Morals“).
Zweifelsfrei vertritt Hume die Konstitutionsthese, dass Gefühle entscheidend an der Entstehung moralischer Urteile oder Handlungen beteiligt sind37. Die zu Beginn des ersten Buches des „Traktats über die menschliche Natur“ vorgenommene Unterscheidung zwischen den Eindrücken (impressions) und den Vorstellungen (ideas) bildet für Hume auch den Ausgangspunkt für die Definition der Gefühle. Ein Affekt ist für Hume
„ein heftiges und spürbares Gefühl des Geistes, wenn ihm irgendein Gutes oder Schlechtes präsentiert wird oder irgendein Gegenstand, der, aufgrund der ursprünglichen Formation unserer Vermögen, geeignet ist, in uns ein Verlangen (appetite) zu verursachen.“38
Die Gefühle, alternativ auch „passions“, „affections“, „sentiments“ oder „emotions“39 genannt, ordnet Hume den Eindrücken (impressions) zu. Jene Eindrücke oder unmittelbaren Bewusstseinsinhalte untergliedert er im ersten Buch des Traktats in Eindrücke der äußeren (impressions of sensation) und der inneren Wahrnehmung (impressions of reflexion). Ebenso werden die Gefühle in:
primäre und sekundäre
direkte und indirekte sowie
heftige und ruhige Gefühle eingeteilt.40
Unter primären Gefühlen (original impressions) versteht Hume die körperlichen Sinnesempfindungen, das Lust- (pleasure) und Unlustempfinden (pain), die als die ursprünglichsten Bewusstseinsgegebenheiten psychologisch nicht weiter ableitbar sind bzw. denen keine Perzeptionen vorangegangen sind. Als Beispiele führt er den Gichtanfall, das Hungergefühl, die allgemeine Liebe zum Leben sowie die Elternliebe an. Diese Gefühle können auch dem nicht erklärt werden, der sie nicht selber empfunden hat. Sie sind undefinierbar. Sie sind auch der Einbildung nicht zugänglich. Affekte können Vorstellungen hervorrufen und diesen Vorstellungen Lebendigkeit verleihen, sodass sich diese in Eindrücke verwandeln.
Wichtig für unseren Zusammenhang ist vor allem, dass die primären Affekte verantwortlich dafür sind, dass wir gut und schlecht unterscheiden. Sie bringen unsere Wahrnehmung von gut und schlecht hervor und sind nicht erst Folge dieser Wahrnehmung.
Jene primären Affekte können zahlreiche andere Affekte auslösen bzw. verursachen, sog. sekundäre (mittelbare) Gefühle (secondary or reflective impressions). Sie entspringen aus ursprünglichen Lust- und Unlustempfindungen. So treten laut Hume etwa die seelischen Affekte des Kummers, der Furcht und der Hoffnung im Gefolge des ursprünglich hervorgerufenen körperlichen Schmerzes einer Krankheit auf.41 Es gibt folglich ebenso zahlreiche sekundäre Gefühle, wie sich aus den Kombinationsmöglichkeiten der Reflexion ergeben können.
Die primären Affekte sind entweder:
alleinige oder
gemeinsam mit einer Vorstellung (idea) verknüpfte Ursache
der sekundären Affekte. Wesentlich bei der Verursachung von sekundären Affekten ist für Hume jedoch, dass eines der beiden primären Gefühle, das Gefühl des Angenehmen (pleasure) oder das Gefühl des Unangenehmen (pain) vorhanden sein muss. Sind keine der beiden Gefühle vorhanden, „so schwinden sogleich auch Liebe und Hass, Stolz und Kleinmut, Begehren und Abneigung“42, folglich zahlreiche sekundäre Gefühle.
Wir nehmen also etwas als gut wahr, weil Freude damit verbunden ist, und vice versa etwas als schlecht, weil es mit Schmerz und dem Gefühl des Unangenehmen verbunden ist.
„Vermöge eines ursprünglichen Instinktes strebt der Geist, das zu erfassen, was ihm ein Gut ist, und das Übel zu vermeiden, auch wenn sie nur seiner Vorstellung gegenwärtig sind und ihrer Existenz nach einer zukünftigen Zeit angehörig erscheinen.“43
Der unterschiedlichen Verursachung zufolge, teilt Hume die sekundären Affekte ein weiteres Mal in direkte und indirekte sekundäre Affekte. Die direkten sekundären Gefühle, die man auch Leidenschaften nennen könnte, werden durch einen Sinneseindruck unmittelbar hervorgerufen; die indirekten sekundären entstehen durch Vermittlung (interposition). Demnach werden die direkten sekundären Affekte unmittelbar durch ein Gut oder Übel ausgelöst, das mit dem Gefühl von Lust oder Unlust gekoppelt ist. Daraus folgt, dass Gefühle wie etwa Freude oder Kummer entstehen, wenn ein Gut oder Übel bereits eingetroffen bzw. real ist. Das Gefühl von Hoffnung oder Furcht hingegen stellt sich ein, wenn sein Eintreffen noch nicht gewiss ist. Hume fasst die Gefühle des Begehrens und der Abscheu, der Freude und des Kummers, der Hoffnung und der Verzweiflung sowie der Zuversicht unter den direkten sekundären Affekten zusammen.44 Das bedeutet, die Wahrnehmung von gut (good) und böse (evil) ist ein direktes sekundäres Gefühl.
Wir begehren das Gute und verabscheuen das Schlechte, weil es ein ursprünglicher Instinkt in uns vorgibt. Dadurch beeinflussen diese Gefühle direkt unseren Willen: „Der Wille gelangt zur Ausübung, wenn entweder das Gute oder die Abwesenheit des Schlechten erreicht werden kann durch irgendeine Handlung des Geistes oder des Körpers.“45
Anders verhält es sich bei den indirekten sekundären Gefühlen. Sie leiten sich aus zuvor empfundenen Affekten ab. Hume subsumiert die Gefühle „Kleinmut, Ehrgeiz, Eitelkeit, Liebe, Neid, Mitleid, Groll, Großmut und die aus ihnen ableitbaren Affekte“46 unter die indirekten sekundären Affekte. Die indirekten sekundären Gefühle entstehen auf komplexem Weg und werden durch Eigenschaften hervorgerufen, die wir jeweils mit der Wahrnehmung von gut bzw. böse verbinden. So sind also auch Liebe oder Hass indirekte sekundäre Gefühle, weil sie sich auf die Wahrnehmungen „gut“ bzw. „böse“ beziehen und mit ihnen verbunden sind. Die Ursache dieser beiden Affekte ist Hume zufolge für uns etwas, was einem denkenden Wesen zugehörig ist. Ebenso wie Stolz und Demut treffen im Rahmen der Entstehung von Liebe und Hass eine Assoziation von Vorstellungen und eine Assoziation von Eindrücken zusammen. Mit den Affekten Wohlwollen und Zorn sind Liebe und Hass durch eine natürliche geistige Beschaffenheit verknüpft – sie folgen aufeinander.
Indirekte Affekte sind im Grunde genommen emotionale Beurteilungen eines Objekts; wir empfinden Lust- oder Unlustgefühle aufgrund der Eigenschaften dieses oder jenes Objekts, die uns wiederum als Quelle für indirekte Affekte dienen. Die Ursache eines indirekten Affekts ist also die Eigenschaft eines bestimmten Objekts, die in uns Lust oder Unlust hervorruft.
Im Gegensatz zu allen anderen Gefühlsgruppen weisen also laut Hume einzig und allein die indirekten Affekte einen intentionalen Charakter auf, da hier die „Objekte und Eigenschaften, die mit Lust bzw. Unlust verbunden sind, auf die Personen, denen sie zuzuschreiben sind, [bezogen werden].“47 So wird in uns die Vorstellung von Stolz oder Demut hervorgerufen, wenn es um unsere eigenen Qualitäten geht. Hume führt in diesem Zusammenhang das Beispiel eines Schriftstellers an, der Stolz empfindet, weil er durch seinen Erfolgsroman eine positive Meinung von sich gewinnt. Der schriftstellerische Erfolg stellt hier die Ursache des Stolzes und der Schriftsteller selbst, das intendierte Objekt dar. Handelt es sich um die Qualitäten anderer Mitmenschen, stellen sich die Gefühle von Liebe oder Hass ein. Des Weiteren subsumiert Hume „Kleinmut, Ehrgeiz, Eitelkeit, Liebe, Neid, Mitleid, Groll, Großmut und die aus ihnen ableitbaren Affekte“48 unter die indirekten Affekte.
Indirekte Affekte sind also auf Personen oder Ereignisse in unserer Mitwelt gerichtet, die von uns als angenehm oder unangenehm bzw. als Güter oder als Übel eingestuft werden.
Die „Ableitung“ des sekundären Eindrucks von der Idee fasst Hume als eine „Art von Attraktion“ auf. Zwischen beidem besteht eine Anziehung, die es uns natürlich erscheinen lässt, dass wir auf eine beliebige Idee auf die jeweilige Weise reagieren. Das Prinzip dieser Attraktion stellt sich als ein „doppelter Zusammenhang“ dar:
„Die Ursache, die den Affekt erregt, steht in Zusammenhang mit dem Objekt, an welchem natürlicherweise der Affekt haftet; die Empfindung, welche die Ursache von sich aus erregt, ist der Empfindung des Affektes verwandt. Aus diesem doppelten Zusammenhang nun, der Vorstellungen einerseits, und der Eindrücke andererseits, entspringt der Affekt. Die eine Vorstellung geht leicht in die ihr entsprechende [correlative] über, und es geht ebenso der eine Eindruck in den ihm ähnlichen und korrespondierenden über. Dieser Übergang aber muß sich um so viel leichter vollziehen, wenn diese beiden Bewegungen einander unterstützen, wenn also der Geist durch den Zusammenhang sowohl der Eindrücke als der Vorstellungen einen doppelten Antrieb dazu erfährt.“49
Ebenso wie bei der Kausalitätsverknüpfung gelten für das Entstehen der Affekte drei Prinzipien: die Assoziation der Vorstellungen, die Assoziation der Eindrücke und die Verbindung beider.
Zugleich werden alle Affekte beeinflusst von allgemeinen Regeln, die in der Gesellschaft gelten und uns mit der Zeit vermittelt wurden. Diese sind sozial anerkannte Maßstäbe, wie wir bestimmte Handlungen, Dinge, Menschen oder Gefühle beurteilen sollten; sie sind die Grundlange von gesellschaftlichen Konventionen und Normen und prägen die Sitten. Die Kriterien sind hier Angemessenheit bzw. Unangemessenheit. In seinem Dialog, den Hume gemeinsam mit seiner Untersuchung über die Prinzipien der Moral veröffentlichte, wird das Verhältnis von gesellschaftlichem Normenhorizont und individuellem moralischen Gefühl genauer beleuchtet (vgl. dazu Kap. 4.3.1).
An dieser Stelle befinden wir uns schon im Bereich dessen, was wir moralische Gefühle nennen würden. Stolz oder Demut wären solche indirekten sekundären Gefühle, denen wir einen moralischen Charakter zuschreiben. Sie sind die Grundlage dafür, wie wir Handlungen, Objekte oder Personen beurteilen. Indirekte Affekte sind für Hume dadurch gekennzeichnet, dass sie sowohl ein Subjekt als auch ein Objekt haben. Subjekt eines indirekten Affektes ist man entweder selbst oder eine dritte Person. Dabei sind nun Stolz und Demut Gemütsregungen, die sich auf unser Selbst beziehen, als Eigenschaften der Seele. Sie geben uns dabei das Gefühl, dass dieses Selbst mit sich identisch ist, dass es also tatsächlich eine konsistente Entität gibt, die wir „Selbst“ nennen. Hume zufolge geben uns die Gefühle Stolz und Demut eine „Idee von uns selbst.“50 Aus der Sicht der Vernunft heraus wirken nämlich alle Eindrücke unzusammenhängend, eine bloße zeitliche Folge von Vorstellungen; die Existenz eine Selbst können wir selber nicht wahrnehmen. Durch die Gefühle aber ergibt sich eine Konsistenz, sodass wir auch in der Zeit uns als selbstidentische Wesen empfinden können. Dies geschieht so, dass ein Eindruck oder Affekt sich aus einer wahrgenommenen Idee ergibt, der sich wiederum auf „eine andere Idee, nämlich die des Selbst“ zuwendet. Es liegt also eine „doppelte Beziehung von Ideen und Eindrücken“ vor. Welche Idee es nun konkret ist, die in uns das Gefühl des Stolzes oder der Demut hervorruft, ist subjektiv und ergibt sich aus konkreten Erfahrungen, die das Individuum in der Vergangenheit gemacht hat. Zudem spielen auch charakterliche Eigenschaften, das Temperament sowie individuelle Lebensbedingungen eine Rolle.
Allerdings ist nicht völlig willkürlich, welche Eindrücke Stolz und welche Demut hervorrufen können. Es gibt auch hier sozusagen intersubjektive Elemente, da nicht jeder Eindruck Grundlage von Stolz sein kann. „Macht und Reichtum, Schönheit oder persönliches Verdienst“ werden bei jedem Menschen eine gewisse positive Gefühlsregung hervorrufen. Auch Liebe und Hass beziehen sich auf eine andere Idee, im Gegensatz zu Stolz und Demut allerdings nicht auf das eigene Selbst, sondern auf andere Personen. Genauer wird dieser Zusammenhang zu erklären sein, wenn es um das für Humes Moralphilosophie entscheidende Gefühl der Sympathie geht. (vgl. Kap. 4.3.2)
Nach der Unterteilung der Gefühle in primäre und sekundäre sowie direkte und indirekte nimmt Hume eine weitere Unterscheidung vor; diese bezieht sich auf ihre Intensität. Während Hume in seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand im ersten Teil des „Traktats über die menschliche Natur“ die Perzeptionen des Geistes nach ihrem Intensitätsgrad differenziert und Eindrücke (impressions) als grundsätzlich intensiver und lebendiger als Vorstellungen (ideas) klassifiziert hat, unterscheidet er im zweiten Buch zwischen heftigen (violent) und ruhigen (calm) Gefühlen. Während es sich bei den direkten Affekten zumeist um heftige handelt, können die indirekten beides sein; Stolz, Demut, Liebe und Hass werden heftig empfunden, ästhetische und moralische Gefühle ruhig. Ruhige Gefühle können allerdings durchaus stark sein. Sie können die heftigen, handlungsmotivierenden Gefühle überlagern und damit abschwächen, so wenn in uns das ruhige Gefühl des Gerechtigkeitsempfindens den direkten Zorn aufgrund eines Verbrechens überlagert und dazu führt, dass wir auf unmittelbare Rache verzichten.
Unter dem ruhigen Gefühl versteht er erstens das genuin ästhetische Gefühl der „Schönheit und Hässlichkeit angesichts einer Handlung, einer künstlerischen Komposition oder äußerer Objekte“51 und zweitens das genuin moralische Gefühl, „das allgemeine Streben nach dem Guten“. Ästhetik und Ethik werden hierbei eng miteinander verknüpft, weshalb beide Gefühle, das genuin ästhetische sowie das genuin ethische, den ruhigen Gefühlen zugeordnet sind.
Jenes allgemeine, rein formale Streben nach dem Guten zählt Hume im Gegensatz zu dem Wohlwollen zu den sekundären Gefühlen:
„Es steht […] fest, dass es gewisse ruhige Begehrungen und Neigungen gibt […]. Diese […] sind zweierlei Art. Entweder es sind gewisse, unserer Natur ursprünglich eingepflanzte Instinkte, wie z.B. Wohlwollen und Übelwollen, Liebe zum Leben, Freundlichkeit gegen Kinder; oder es ist das allgemeine Streben nach dem Guten und die Abneigung gegen das Übel, rein als solche.“52
Daraus ergibt sich, dass es unter der Kategorie der ruhigen Gefühle sowohl primäre als auch sekundäre Gefühle gibt.
Neben den ruhigen Gefühlen existieren die heftigen Gefühle, wie die „der Liebe und des Hasses, des Grams und der Freude, des Stolzes und der Niedergedrücktheit.“53 Weiterhin ordnet er den „Wunsch, dass unsere Feinde bestraft werden und unsere Freunde glücklich werden“54, also ein gewisses Rachegefühl und angemessenes Wohlwollen sowie „Hunger, Wollust und einige andere körperliche Begierden“ den heftigen primären Gefühlen zu. Hier ist zu betonen, dass die genuin moralischen Gefühle nicht dem Bereich der heftigen Gefühle zugeordnet sind.
Hume selbst räumt ein, dass jene Unterscheidung in ruhige und heftige Gefühle nicht auf absoluter Genauigkeit beruht, aber eine grobe Einteilung der Affekte durchaus dem Zwecke seiner Untersuchung der Affekte diene:
„Diese Einteilung ist weit entfernt von Genauigkeit. Das Entzücken an Poesie und Musik erreicht oft die größte Höhe, während jene anderen Eindrücke, die speziell Affekte genannt werden, zu einer so sanften Gefühlserregung abgeschwächt sein können, dass sie gewissermaßen unbemerkbar werden.“55
Das Verhältnis von Vernunft und Affekten
Vernunft ist für Hume nun kein Vermögen, das vom Reich der Gefühle voll und ganz getrennt ist; im Gegenteil. Die Tätigkeiten unserer Vernunft werden von ihm als affection bestimmt, also als Bewegungen des Gemüts,
„[…] die von gleicher Art sind wie die Affekte, die aber ruhiger wirken und keine Unordnung in der Gemütsverfassung verursachen. Diese Ruhe verleitet uns zu einem Irrtum ihnen gegenüber und bewirkt in uns die Ansicht, dass es sich bei ihnen um Schlussfolgerungen allein unserer intellektuellen Vermögen handelt.“56
Das bedeutet, dass Vernunft eigentlich ein ruhiger sekundärer Affekt ist, was schon einen Vorschein darauf gibt, welche Rolle sie für das moralische Gefühl spielen kann. Und auch, wenn wir meinen, nach Motiven zu handeln, denen keinerlei emotionaler Charakter zukommt, ist dies doch eigentlich eine Täuschung. Wir nehmen kaum ein Gefühl wahr, weil das des Vernunftschlusses so ruhig ist; es handelt sich mithin um ein „kleines Gefühl“57. „Humes Herausforderung an die Philosophen bestand also darin, daß er der Vernunft keine fundamentale Rolle in der Entwicklung dieses und anderer zentraler Begriffe zuweisen wollte“, schreibt Manfred Kühn in seiner Einleitung zu Humes „Untersuchung über die Prinzipien der Moral.“58 Die Frage ist nun, wie Hume selber im Bereich der Ethik dieser Herausforderung begegnet.
Das moralische Gefühl in Humes „Untersuchung über die Prinzipien der Moral“
Die Bedeutung der Methaethik
Wir bewegen uns bei der Behandlung der Frage nach der eigentlichen moralischen Fakultät im Menschen auf dem Feld der Metaethik.59 Die Metaethik versucht zu bestimmen, welche Faktoren auf die Moral im Allgemeinen einwirken und was moralische Urteile ausmacht. Sie trifft bezüglich der Moralität einzelner Handlungen keine inhaltlichen Aussagen. Zum einen geht es um die Frage, ob Ethik ein Denkbereich ist, in dem etwas über die Welt erkannt wird, indem also Aussagen über Dinge gemacht werden (Kognitivismus), oder ob etwas befürwortet wird (Non-Kognitivismus), was bedeuten würde, dass moralische Sätze nicht wahrheitsfähig wären. Im Bereich des Kognitivismus ist zu unterscheiden zwischen realistischen und antirealistischen Positionen, in denen die Frage gestellt wird, inwiefern man erkennen kann, ob Werte objektiv (Realismus), also moralische Tatsachen sind.
David Humes Ethik lässt sich mit dem Terminus Non-Kognitivismus bezeichnen. Deren Merkmale, Plausibilität und Konsequenzen sollen im Folgenden erörtert werden.
Grundsätzlich sind in der Diskussion um die Rolle von Vernunft und Gefühl im moralischen Urteil drei Aspekte zu unterscheiden: Der erste betrifft den Ursprung der moralischen Handlungen bzw. Urteile. Der zweite betrifft den moralischen Wert einer Handlung: Ergibt er sich aus den Gefühlen, die man gegenüber Mitmenschen hat, oder bestimmt sich seine Verbindlichkeit durch die praktische Vernunft? Drittens schließlich stellt sich die Frage nach der Motivation für moralisches Handeln. Rationalisten sind der Auffassung, dass Menschen durch Vernunftsätze motiviert werden, während Empiristen diese Rolle den Gefühlen von Lob oder Missbilligung zusprechen.
Einleitend ist zudem festzuhalten, dass sich Humes Ansatz von anderen Theorien seiner Zeit und der Philosophiegeschichte insofern absetzt, als er zum einen, wie die anderen Denker der Aufklärung, eine rein göttliche Herkunft von Moral hinterfragt, zum anderen auch, im Gegensatz zu Platon etwa, nach dem Ursprung der Moral in der menschlichen Natur sucht. Bei der Frage, ob Moralität die menschliche Natur transzendiert, indem sie wesenhaft als rational bestimmt wird und daher durch Vernunftschlüsse von höheren Prinzipien abgeleitet werden kann, bezieht Hume insofern Stellung, als er sie durch empirische Beobachtung zu finden glaubt. Zieht man Humes Zurückhaltung angesichts des Vermögens der Vernunft in der reinen Erkenntnis in Betracht, ist es nur konsequent, dass er sich auch in der Ethik für einen anthropologischen Ansatz entscheidet, der sich an den tatsächlichen Vermögen der menschlichen Psyche orientiert. Er urteilt über Philosophen, die glaubten, moralische Wahrheiten ohne Blick auf die condition humaine erkennen zu können, dass sie Theologen ähneln, die meinten, sie allein durch die Lektüre heiliger Schriften finden zu können.
Seine Untersuchungen sind daher geprägt von realen Beispielen aus der Geschichte, der Politik und dem Alltagsleben, in denen er die Gemeinsamkeit beobachtet, dass das Gefühl (sentiment) die antreibende Kraft von Moral ist. Da er sie zugleich in einer Vielzahl von Gefühlen wiederfindet (im Gegensatz zu Zeitgenossen, die sie auf eine einzige Tugend reduzieren wollten, wie bei Hutcheson etwa die Güte oder Wohlwollen [benevolence]), zieht er oft die Analogie zur Sinneswahrnehmung herbei, die auch aus einer Vielfalt einzelner Eindrücke besteht:
„Morality is nothing in the abstract Nature of Things, but is entirely relative to the Sentiment or mental Taste of each particular being; in the same Manner as the Distinction of sweet and bitter, hot and cold, arise from the particular Feeling of each Sense or Organ. Moral Perceptions therefore, ought not to be class’d with the Operations of the Understanding, but with the Tastes or Sentiments.”60
Hume widersetzt sich der Ansicht von Hutcheson, dass alle moralischen Prinzipien auf unser Wohlwollen reduziert werden können, weil er bezweifelt, dass Wohlwollen unser ganz normales alltägliches Verhalten ausreichend überwinden kann. Nach Humes Beobachtung sind wir sowohl egoistisch als auch human. Wir besitzen Gier und auch „begrenzte Großzügigkeit“ (limited generosity) – Dispositionen zur Freundlichkeit und Offenheit, die stärker auf Verwandte und Freunde ausgerichtet sind und weniger von Fremden erregt werden. Moral beruht also auf einem Empfinden, das dem Geschmack (Taste) ähnlich ist. Die Analyse der Moral darf sich daher nicht auf die Außenwelt konzentrieren und die menschliche Natur transzendieren, sondern sie muss sich auf die Merkmale und Eigenschaften dieses Empfindens selbst fokussieren. Die Analogie zwischen Sinneswahrnehmung und moralischem Gefühl wird im Folgenden unsere Untersuchung der Hume’schen Ethik leiten.
4.2 Das Verhältnis von Vernunft und Gefühl im moralischen Urteil
„Die Vernunft ist die Sklavin der Gefühle und soll es sein“61 („reason is and ought only to be the slave of the passions“), behauptet David Hume an prominenter Stelle; „sie darf niemals eine andere Funktion beanspruchen, als die, denselben zu dienen und zu gehorchen.“ Zudem bezeichnet er das moralische Urteil also als „nicht von Vernunft abgeleitet“. Handelt es sich bei Humes Metaethik folglich um einen Irrationalismus? Ergibt sich daraus eine Indifferenz gegenüber moralischen Urteilen, oder ein ethischer Skeptizismus oder Relativismus? Das angeführte, zentrale Zitat muss nun gedeutet werden, um darauf eine Antwort zu geben und Humes Theorie des moralischen Gefühls zu verstehen.
Seine Ablehnung des ethischen Rationalismus geschieht auf zweifache Weise. Ethische Rationalisten neigen zu der Feststellung, dass moralische Eigenschaften durch die Vernunft entdeckt werden, und dass auch das, was moralisch gut ist, im Einklang mit der Vernunft steht und das, was moralisch schlecht ist, unvernünftig ist. Hume lehnt beide Thesen ab. Einige seiner Argumente richten sich an das eine und andere an die andere These.
Zum einen haben die Gegenstände der Vernunft einen propositionalen Gehalt, d. h., sie können wahr oder falsch sein. Auf Gefühle aber wie Angst, Freude, Begehren usw., trifft dies nicht zu. Sie sind weder wahr noch falsch bzw. die Kategorie der Wahrheit lässt sich nicht sinnvoll auf sie anwenden. Das bedeutet, dass die Vernunft auch auf sie nicht Einfluss nehmen kann. Jedoch kann ein Gefühl aber auf etwas gerichtet sein, es ist intentional. Das Gefühl der Angst beispielsweise ist auf die Wahrnehmung der Dunkelheit oder des Alleinseins gerichtet, und so kann die Vernunft Mittel ersinnen, die Gegenstände des Gefühls zu verändern. Der Impuls zu dieser Veränderung der Dunkelheit etwa geht aber auch nicht wieder nicht von der Vernunft aus, sondern von dem Gefühl der Angst. Insofern ist die Vernunft Sklave der Gefühle.
Zum anderen ist die Vernunft allein nicht in der Lage, festzustellen, welche Handlungen erstrebenswert sind und welche nicht.62 Ihre Rolle ist beschränkt darauf, die Mittel anzugeben, mit denen bestimmte Zwecke erreicht werden können. Über die Zwecke selbst kann sie keine Auskunft geben. Hume zufolge hat die Vernunft keine Kraft, den Menschen zu Handlungen zu motivieren. Die bloße Einsicht in die Richtigkeit eines Verhaltens reicht nicht aus, um uns dieses Verhalten nachahmen zu lassen. Denn vernünftiges Schließen und Argumentieren entdeckt Beziehungen von Ideen; Laster und Tugend sind aber nicht identisch mit irgendeinem der vier philosophischen Relationen (Ähnlichkeit, Kontrast, Qualitätsgrad oder Mengen- und Zahlenverhältnis), deren Präsenz nachgewiesen werden kann. Sie könnten auch nicht mit einer anderen abstrakten Beziehung identisch sein; denn solche Beziehungen können auch zwischen Gegenständen wie Bäumen bestehen, die nicht in der Lage sind, moralisch gut oder böse zu sein. Darüber hinaus würde eine solche Argumentation, wenn Laster und Tugend durch rationales Denken erkannt würden, ihre inhärente Kraft offenbaren, Motive bei allen zu produzieren, die sie erkennen; aber es können von vornherein keine kausalen Zusammenhänge entdeckt werden. Die kausale Argumentation hingegen schließt Tatsachenfragen im Zusammenhang mit Handlungen, insbesondere deren Ursachen und Wirkungen; aber das Laster einer Handlung (ihre Bosheit) findet sich nicht in ihren Ursachen oder Wirkungen, sondern zeigt sich nur, wenn wir die Meinung des Betrachters einholen. Deshalb werden Gut und Böse nicht allein durch die Vernunft entdeckt.
Also können wir auch aus reiner Vernunfteinsicht heraus auch nicht selber moralisch handeln. Zudem ist die Vernunft nicht in der Lage, Werte zu erkennen. Wie wir gesehen haben, kommt diese Aufgabe allein dem Gefühl zu, nämlich dem direkten Affekt von gut oder böse, bzw. Billigung oder Missbilligung. Das Reich der Werte ergibt sich allein aus unserer Fähigkeit zu empfinden. Es bedarf laut Hume einer anderen Schubkraft, wenn es über die Tatsachenbeschreibung hinaus zu einem Handlungsvollzug kommen oder nicht kommen soll (Soll-Zustand), da die Vernunft allein uns nichts darüber sagen kann, ob die von ihm vorkalkulierten, tendenziellen Folgen einer Handlung liebens- oder hassenswert sein werden.63
Vernunft ist nach Hume die Erkenntnis von Wahrheit und Irrtum. Sie ist, wie wir sehen werden, den Affekten untergeordnet.
„Bin ich ärgerlich, so hat mich der Affekt tatsächlich ergriffen, und in dieser Gefühlserregung liegt so wenig eine Beziehung zu einem anderen [damit gemeinten oder dadurch repräsentierten] Gegenstand, als wenn ich durstig oder krank oder über fünf Fuß groß wäre. Es ist also unmöglich, daß dieser Affekt von der Vernunft bekämpft werden kann oder der Vernunft und der Wahrheit widerspricht. Denn ein solcher Widerspruch besteht in der Nichtübereinstimmung der Vorstellungen, die als Bilder von Dingen gelten, mit diesen durch sie repräsentierten Dingen selbst.“64
Nun ist aber die Feststellung, dass moralisches Bewusstsein und auch die Ethik auf Gefühlen fußen, noch keine Aussage über die Richtigkeit eines Urteils oder eines Wertes. Fundiert man die Moral im menschlichen Gefühl, ergibt sich freilich das Problem der Subjektivität moralischer Urteile. Die Vernunft als Vermögen verstanden, das die Objektivität der Realität zumindest ansatzweise zu erkennen vermag, würde es nahelegen, dass auch eine aus ihr entspringende Moral objektiven Charakter hat. Auch die Erkennbarkeit und „Verständlichkeit“ von moralischen Urteilen lässt sich leichter begründen, wenn diese auf einem der mathematischen oder logischen Schließen ähnlichen Denkverfahren beruhen würden. Sobald man aber, wie Hume, ein in besonderem Maße von äußeren und individuellen Faktoren abhängiges Vermögen wie das Gefühl zur Hauptinstanz der Moral macht, ergibt sich die Frage nach der Erkennbarkeit und Allgemeingültigkeit moralischer Urteile.
Hume selber referiert die beiden konkurrierenden Schulen der Metaethik in seinem Enquiry. Er zeigt, dass diejenigen, die von der Realität moralischer Unterscheidungen ausgehen, triftige Begründungen vorweisen können. Die ethischen Rationalisten ziehen aus einer langen Kette von Beweisen, aus zitierten Beispielen, aus angeführten Autoritäten und Analogien, aus entdeckten Fehlschlüssen den Schluss auf die Wahrheitsgemäßheit eines moralischen Urteils. Es müsse also allein auf der Verstandestätigkeit beruhen, da nur der Verstand zu argumentativen Aussagen über die Wirklichkeit gelangen kann.
Diejenigen hingegen, die von der Grundlage der Moral im Gefühl überzeugt sind, betonen die Tatsache, dass ein Urteil niemals rein in der Beschaffenheit einer Sache zu finden ist, also auch nicht von der Vernunft in dieser auffindbar zu machen ist, sondern in dem Temperament des urteilenden Menschen selber verankert ist. In diesem Sinne sind sie nicht wirklich wahrheitsfähig oder falsifizierbar, weil sie eher dem Geschmacksurteil ähneln, über das sich bekanntlich nicht streiten lässt.
Hume konstatiert also, dass sowohl Vernunft als auch Gefühl (sentiment) in fast allen moralischen Schlüssen eine Rolle spielen. Das letzte Wort jedoch haben für ihn die Gefühle, was aus der Analyse des Verhältnisses von Gefühl und Vernunft in der Erkenntnistheorie zu erwarten war.
„[…] es ist wahrscheinlich, sage ich, dass dieses endgültige Urteil von einem inneren Sinn oder Gefühl abhängt, das allen Menschen von Natur aus gemeinsam ist.“65
Gleichwohl versucht Hume nun eine Vermittlung von rationalistischer und emotistischer Theorie. Das moralische Urteil nämlich ist zu vergleichen mit einem Geschmacksurteil, wie Hume in seiner Abhandlung „Of the Standard of Taste“ ausführt. Auch in der Untersuchung über die Prinzipien der Moral befindet Hume, dass Moral und Kritik nicht so sehr Eigenschaften des Verstehens als von Geschmack und Gefühl sind. Schönheit, ob moralische oder natürliche, ist gefühlt, nicht erkannt.66 Wenn nun aber das moralische Urteil dem ästhetischen ähnlich bis identisch ist, muss es dann nicht auch subjektiv bleiben? Hume führt den Vergleich aus: Wir erleben auf einen Eindruck eine erste emotionale Reaktion wie Ekel oder Begeisterung. Die Vernunft kann nun, indem sie vergleicht, analysiert, nach Gründen sucht etc. diese ersten Reaktionen des Gefühls bestätigen oder verbessern. Dadurch entwickelt sich „guter Geschmack“ oder „Urteilskraft“. Auch im moralischen Bereich verfeinern wir unseren ersten moralischen Eindruck, das Gefühl der Missbilligung etwa, wenn einem Freund Unrecht widerfährt, durch den Vernunft, der die Situation genauer untersucht und etwa feststellt, dass der Freund sich zuvor unfair verhalten hatte.
Nach Hume ist daher doch eine argumentative Auseinandersetzung über Werturteile möglich. Es gibt folglich einen Standard, an dem sich Geschmacksurteile messen lassen müssen. Manche Urteile sind zwar nicht im strengen Sinn falsch (im Sinne von unwahr), aber doch unangemessen oder sogar absurd. Nach Hume muss auch im moralischen Urteilen ein genereller Standpunkt (steady and general point of view) eingenommen werden, der eine verlässliche, objektive Beurteilung ermöglicht. 67 An jenen festen und allgemeinen Standpunkt gelangen wir jedoch nur mittels Reflexion. Hume spricht in diesem Zusammenhang von dem Bedürfnis unserer Vernunft nach einer „ruhigen und allgemeinen gleichmäßigen Beurteilung.“68 Der Vernunft kommt im Berichtigungsprozess unserer Gefühle also eine wesentliche Funktion zu, da sie subjektive Erscheinungen bzw. Gefühle reflektiert ggf. korrigiert, um uns so zu einem „stetigeren und konstanteren Urteil“69 zu führen. „Die Sprache der Moral ist eine andere als die der bloß privaten Meinungsäußerung.“70
Auf die Frage, wie dem allgemeinen Skeptizismus im Bereich der Ethik, der sich aus der Fokussierung auf das Gefühl ergibt, zu entgehen ist, antwortet Hume also mit der Feststellung, dass Gefühle für das moralische Urteil notwendig sind, weil sie handlungsmotivierend und wertesetzend sind, aber nicht ausreichend. Die emotionale Reaktion auf eine Handlung etwa ist zwar der Ursprung unseres Urteils, aber nicht die Basis für seine Richtigkeit. Diese ergibt sich, wie im ästhetischen Bereich, aus der Verfeinerung durch den Vernunft. Zwar haben die heftigen Affekte einen größeren Einfluss auf unseren Willen, doch können die ruhigen Affekte, die, eine Form von Vernunft darstellen, durchaus einen ebenbürtigen Einfluss haben, wenn sie durch Reflexion und Entschlossenheit begleitet werden.
„Die menschliche Natur besteht nun einmal aus zwei Hauptfaktoren, die zu allen ihre Handlungen notwendig sind, nämlich aus den Neigungen und dem Verstande; nur die blinden Betätigungen der ersteren, ohne Leitung des letzteren, machen die Menschen für die Gesellschaft untauglich.“71
In der Untersuchung über die Prinzipien der Moral schreibt Hume, er sei geneigt zu vermuten, dass „Vernunft und Gefühl bei nahezu allen moralischen Entscheidungen und Schlüssen zusammenspielenzusammenwirken.“ Anstatt die Natur von Tugend und Laster und unser Wissen über sie in Bezug auf die zugrunde liegenden Merkmale des menschlichen Geistes zu erklären, schlägt er vor, alle Eigenschaften, die wir vom gesunden Menschenverstand als Tugenden und Laster kennen, zu sammeln, zu beobachten, was die in jeder Gruppe gemeinsam haben, und daraus die „Grundlage der Ethik“ zu entdecken (EPM 1.10). Er findet diese Grundlage in dem inneren Sinn oder Gefühl. Das „endgültige Urteil“ über einen Charakter etwa hängt wahrscheinlich „von einem inneren Sinn oder Gefühl“ ab.
„Um aber einer solchen Empfindung den Weg zu ebnen und von ihrem Gegenstand eine korrekte Beschreibung zu geben, ist es häufig notwendig, wie sich zeigt, dass viele Überlegungen vorangehen, feine Unterscheidungen gemacht, richtige Schlüsse gezogen, entfernte Vergleiche angestellt, verwickelte Beziehungen untersucht und allgemeine Tatsachen ermittelt und genau bestimmt werden.“72
Es sei „nötig, eine Fülle rationaler Überlegungen einzubeziehen, um das richtige Gefühl zu empfinden; und häufig ist hier eine Geschmacksverwirrung durch Argument und Reflexion korrigierbar.“73 Vernunft und Urteil können so
„[…] gewiß mittelbare Ursache einer Handlung werden, indem sie nämlich zu einem Affekt Gelegenheit geben oder ihm die Richtung anweisen; man darf aber nicht behaupten, daß einem solchen Urteil vermöge seiner Wahrheit oder Falschheit sittlicher Wert oder Unwert anhafte.“74
Die Vernunft ist also einerseits zwar Sklave der Gefühle (passions), auf der anderen Seite aber besteht ihre Rolle auch darin, uns von den Gefühlen zu befreien, ihre Macht zu beschränken und sie in eine relativierende Perspektive zu rücken.
Hieran ist zu sehen, dass Hume davon ausgeht, dass der Nachweis, dass das moralische Gefühl seinen Ursprung in der allgemeinen menschlichen Natur hat, den moralischen Skeptizismus widerlegt. Er will durch empirische Untersuchungen zu Verallgemeinerbarkeiten über die menschliche Natur finden. Indem moralische Urteile für rationale Argumentationen offen sind, eröffnet sich ein Feld des Intersubjektiven, das dem bloßen Gefühl nicht zukommt.
Daher gibt es für Hume eine Grenze des moralischen Argumentierens: Einen verstockten Menschen, der stur an fanatischen Urteilen festhält, können wir keines logischen Widerspruchs überführen. Bei moralischen Urteilen ist zwar rationale Argumentation möglich, selbst wenn beide Urteilende über die gleichen Annahmen und Fakten bezüglich der zu beurteilenden Handlung verfügen. Die Letztbegründung aber kann die Vernunft nicht leisten.
„The ulitmate ends of human actions can never, in any case be accounted for by reason, but recommend themselves entirely to the sentiments and affections of mankind, without any dependence on intellectual faculties .“75 ZIZT???
Ein Beispiel, das Hume anführt, verdeutlicht das Verhältnis von Vernunft und Gefühl mit Bezug auf die menschliche Moral gut. Wenn wir vor die Entscheidung gestellt sind, ob wir einen Finger verlören oder die ganze Welt zerstört würde, wären viele im Zweifel, ob sie ihren Finger opfern würden. Denn das direkte, primäre und heftige Gefühl des Schmerzes ist handlungsmotivierender als die Vorstellung einer zerstörten Welt und das mit ihm verbundene indirekte, sekundäre und ruhige Gefühl des Mitleids. Die Vernunft aber kann diese Bevorzugung des eigenen Fingers nicht logisch verstehen: „Es läuft der Vernunft nicht zuwider, wenn ich lieber die Zerstörung der ganzen Welt will, als einen Ritz an meinem Finger.“76 Anderseits widerspreche es auch „nicht der Vernunft, wenn ich meinen vollständigen Ruin auf mich nehme, um das kleinste Unbehagen eines Indianers oder einer mir gänzlich unbekannten Person zu verhindern.“77
Die letzte, bewertende Komponente kommt nicht ihm zu, sondern dem Gefühl. Es gilt das Urteil Bernd Gräfraths: „Hume sieht den Menschen als ein Naturwesen, das letztlich eher von seinen Wünschen und Leidenschaften als von abstrakten Überlegungen bewegt wird.“78
Da die Vernunft nun „kühl und gleichgültig“79 ist, kann er auch nicht unsere Leidenschaften und Handlungen beeinflussen; er bleibt ohnmächtig („impotent“). Moral jedoch, schreibt Hume, hat jedoch einen Einfluss auf „actions and affections“, also kann sie nicht von der Vernunft abgeleitet sein. Die Moral treibt Leidenschaften an und ruft Handlungen hervor oder verhindert sie. Die Vernunft hingegen kann uns bloße Argumente pro und contra moralischer Bewertungen anführen, Tatsachen festhalten und für ein bestimmtes Ziel förderliche Mittel aufzeigen.80 Aber selbst da ist es nötig, dass das Gefühl uns die Bereitschaft ermöglicht, unserer Vernunft auch zu vertrauen. Selbst das „Hören“ auf die Vernunft als der Leiterin, die die hinreichenden Mittel zu einem bestimmten Zweck angibt, ist von Gefühlen bedingt.81 Es bleibt als eigentliche „Triebfeder“, die Einfluss auf unseren Willen hat und den aktiven Impuls für unser Handeln gibt, das moralische Gefühl.
Dieses Gefühl basiert wiederum auf dem natürlichen Prinzip der Sympathie (sSympathy). Hume behauptet, es gebe in der menschlichen Natur so etwas wie einen uneigennützigen, an dem Gemeinwohl orientierten Antrieb, das Wohlwollen (bBenevolence) oder die Menschlichkeit (hHumanity) gibt, denen das Prinzip der Sympathie zugrunde liegt. Daraus begründet sich die These von der prinzipiellen Gleichheit des moralischen Gefühls bei den Menschen; es findet seinen Kern in der gemeinsamen, menschlichen Natur. Hume fügt hinzu, dass Sympathie außerdem die Fähigkeit beschreibt, sich in andere hineinversetzen bzw. mit ihnen mitfühlen zu können, wodurch die Möglichkeit einer „zwischenmenschlichen, affektiven Kommunikation“82 entsteht, bei der wir unsere Gefühlszustände untereinander austauschen. Es ist ein natürliches und aktives Prinzip in uns, das automatisch und unvermeidlich wirkt, wenn wir beispielsweise bei dem Anblick menschlichen Leids oder Glücks unmittelbar mitleiden oder uns mitfreuen.
Während die Vernunft uns also, als ein passives Instrument, lediglich Mittel zum Erreichen eines Ziels aufzeigen kann, bestimmen unsere „Gefühle und leidenschaftlichen Willensbewegung“ hingegen das letzte Ziel unserer Handlung.83
„Da nun Tugend ein Endzweck und um ihrer selbst willen erstrebenswert ist, so muss notwendigerweise irgendein Gefühl vorhanden sein, an welches sie rührt, ein inneres Empfinden, dass zwischen dem moralisch Guten und Bösen unterscheidet und das sich dem einen zuwendet und das anderer verwirft.“84
Es handelt sich beim moralischen Gefühl daher nicht um einen Eindruck, der der äußeren Wahrnehmung (iImpressions of sensation) entspringt, sondern der inneren bzw. Selbstwahrnehmung (iImpressions of reflexion).85 Auf der Grundlage dieses Eindrucks oder unmittelbaren Gefühls der Zustimmung oder Ablehnung zu einer, dem Beobachter vorliegenden Handlung, besteht also unser moralisches Urteil.86
Tugend und Laster, findet Hume, erzeugen in uns Lust bzw. Unlust. Dabei konzediert Hume, dass das besondere moralische Gefühl der Zustimmung zu einer tugendhaften Handlung, durch seine „sanften“ und „zarten“ Qualitäten, anderen angenehmen Gefühlen in der Regel unterlegen ist, wie beispielsweise Lust und Unlust oder die Lust zur Befriedigung eigennütziger Antriebe etc.87 Und doch können wir jenes spezifische, moralische Gefühl mittels des reflektierenden Verstandes von anderen angenehmen Gefühlen wohl unterscheiden.88
Beim Fällen von moralischen Urteilen ist es immer wichtig, zu wissen, woher gewisse, möglicherweise widersprüchliche Gefühle stammen und was ihre Quellen sind. Schließlich sollte nicht einfach das stärkste gewählt werden, sondern das, was sich am richtigsten anfühlt. Die Vernunft ist demnach notwendig, um aus vielzähligen, angenehmen Gefühlen, das einzig natürliche und richtige Gefühl zu empfinden und herauszukristallisieren, welches über die Zustimmung oder Ablehnung einer Handlung entscheidet.89 Hume spricht dabei der Vernunft drei wesentliche Funktionen zu, die dafür sorgen, dass der Weg für ein unverzerrtes moralisches Gefühl bereitet wird, welches der Missachtung von subjektiven Interessen, Voreingenommenheit und Parteilichkeit bedingt. Erstens kalkuliert unser Vernunft alle tendenziellen Folgen einer Handlung, die uns vorab bekannt sein müssen, ehe unser moralisches Gefühl darüber entscheidet, ob die Handlung gebilligt oder missbilligt wird. Zweitens bezieht er die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Folgen mit ein. Drittens kann uns die Vernunft den Einfluss verschiedener Faktoren auf unser moralisches Gefühl, wie die, der Erziehung im allgemeinen sowie im religiösen Sinne, der in der Kultur verankerten Werte und Sitten einer Gemeinschaft, in der man lebt, und der persönlichen Nähe zu anderen (Familie, Freunde etc.), durch Analyse und Reflexion erkennen lassen, es dahingehend korrigieren, sodass wir zu dem natürlichen Empfinden oder Gefühl zurückgelangen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir für jenes kritische Bewusstsein ebenfalls Erfahrungen von eigener Parteilichkeit, Voreingenommenheit und Subjektivität unserer Urteile gemacht haben müssen. Obwohl der Einfluss von Erziehung unser moralisches Empfinden verzerren kann, ist die Erziehung dennoch wichtig, um uns selbst zu erziehen und uns dadurch zu unserem natürlichen Gefühl zurückzuführen. In diesem Zusammenhang spricht Hume von Übung. Erziehung hat zur Aufgabe, das moralische Urteil auf die Einhaltung der konventionellen Regeln zu erweitern. Sie trägt dazu bei, dass unsere Wertschätzung von Gerechtigkeit gesteigert wird.
Es zeigt sich nun, dass die Antwort auf die zu Beginn gestellte Frage, ob das moralische Urteil der Vernunft oder dem Gefühl entstammt, weder die Vernunft noch das Gefühl ausschließt. Es besteht eine Zusammenarbeit zwischen Vernunft und Gefühl, dennoch bestimmt das moralische Gefühl das endgültige Urteil und spielt somit die entscheidendere Rolle.
Zugleich aber können wir auf die Frage zurückkommen, inwiefern wir uns als Subjekte moralischen Urteilens von den Tieren unterscheiden. Wir hatten gefragt: Wenn sowohl der Mensch und das Tier in erster Linie durch Eindrücke und Gefühle zu Erkenntnis kommt, und es ebendiese Eindrücke und Gefühle sind, die ihre Handlungen motivieren und lenken; wenn zudem das moralische Urteil in erster Linie auf eben diesen Eindrücken und Gefühlen beruht – kommt dem Menschen dann noch eine Sonderstellung im Bereich der Ethik zu? Ist der Mensch das einzige uns bekannte Lebewesen, das moralisch urteilen kann, oder müssen wir moralisches Empfinden (und Urteilen), wenn auch evtl. nur in Ansätzen, auch bestimmten Tieren zusprechen?
Hume kommt im dritten Buch des „Traktats“, „Über Moral“, auf eine originelle Antwort, die sich gleichwohl konsequent in seinen Gedankengang einfügt.90 Da wir Eigenschaften des Geistes, die in uns ein angenehmes Gefühl auslösen, Tugenden nennen, und solche Eigenschaften, die uns schlechte Gefühle verursachen, Laster, nennen wir auch die Träger dieser Eigenschaften tugend- bzw. lasterhaft. Wenn uns jemand unprovoziert beißt etwa, sind wir empört, und wir halten seine Tat und ihn für böse. Allerdings sprechen wir das gleiche Urteil nicht einem Tier zu, das uns unprovoziert beißt. Es fühlt sich für uns einfach anders an, von einem Tier, als von einem Menschen gebissen zu werden (vom direkten heftigen Gefühl des Schmerzes einmal abgesehen), und wir sind nicht in erster Linie empört, wenn uns ein Tier beißt. Einem Menschen gegenüber empfinden wir das Gefühl der Empörung. Das führt dazu, dass wir dem Menschen ein moralisches Verhalten unterstellen, dem Tier aber nicht. Freilich liegt in diesem Gefühl keine absolute Aussage über die Möglichkeit moralischen Handelns, die für das Tier bestehen könnte, aber es ist eine Begründung unserer „Sonderstellung“ im Bereich der Moral.
In einer Moralphilosophie, wie die von Hume, die in einem moralischen Gefühl wurzelt, stellt sich nun die Frage, wodurch sichergestellt wird, dass das moralische Empfinden bei allen Menschen gleich ist. Die Antwort darauf beruht auf Humes These von der prinzipiellen Gleichheit des moralischen Gefühls bei den Menschen; dieses findet seinen Kern in der gemeinsamen, menschlichen Natur. Zudem formen wir durch den natürlichen Austausch unserer Empfindungen mit anderen empfindenden Lebewesen (Sympathie, s. Kap. 4.3.2) und durch das Mitteilen von Überzeugungen, einen allgemeinen, unveränderlichen Maßstab, nach dem wir Handlungen billigen oder missbilligen. Außerdem sorgt wie bereits erläutert auch unsere Vernunft, der mit dem Vermögen der Reflexion ausgestattet ist, dafür, dass wir unsere Parteilichkeit und Voreingenommenheit erkennen, unser moralisches Gefühl dahingehend korrigieren können und so unser moralisches Urteil auf einem unverzerrten, unbeeinflussten und unvoreingenommenen Empfinden bzw. Gefühl basiert.91
4.3 Das Problem des moralischen Relativismus bei Hume
Aus dem Gesagten folgert Hume, dass moralische Urteile nicht auf der bloßen Erkenntnis von Vorstellungsbeziehungen oder der Wahrnehmung der Realität beruhen kann, da die Vernunft keinen alleinigen Einfluss auf die Affekte hat. Es folgt zudem aus der Abhängigkeit oder Subordination der Vernunft von den Gefühlen („rReason is and ought only tob e the slave oft he passions“), dass aus dem Sein kein Sollen gefolgert werden kann.92 Hume ist überzeugt, „dass die Unterscheidung von Laster und Tugend nicht allein auf den Beziehungen zwischen Gegenständen beruht und nicht durch die Vernunft erkannt wird.“93
Ein ethischer Imperativ, der sich in einem Sollen ausdrückt, wäre ein Vernunftprinzip, da die Vernunft jedoch nicht handlungsmotivierend ist, lässt sich aus ihr nichts ableiten. (Hume’sches Gesetz). Ob ein Mord etwa moralisch verwerflich ist, ergibt sich daher nicht aus der Eigenschaft der Handlung. Ihre Verwerflichkeit gründet allein in dem Gefühl, das wir verspüren, wenn wir mit dem Ereignis konfrontiert werden. Ein Werturteil ist in erster Instanz nicht mehr als Ausdruck eines Gefühls; es kann deshalb weder wahr noch falsch sein. Wie wir gesehen haben, können für Hume nur zwei Typen von Sätzen einen Wahrheitsanspruch erheben: Sätze, die eine Aussage über die Beziehung von Vorstellungen (ideas) enthalten und Sätze, die eine Aussage über den Bereich der Erfahrung machen. Bei den „Gegenständen“ der Moral, Affekten, Willensakten und Handlungen ist für Hume die Frage nach der Übereinstimmung moralischer Aussagen mit der Wirklichkeit daher sinnlos, weswegen für sie auch kein Wahrheitsanspruch erhoben werden könne
Hier nun öffnet sich wieder die Frage nach der Gefahr eines ethischen Relativismus, die im Gefühlssubjektivismus Humes aufscheint. Um dem Vorwurf völliger Beliebigkeit moralischer Sätze zu entgehen, untersucht Hume die Elemente der menschlichen Psyche und fahndet nach einer übergreifenden Eigenschaft im Gefühlsleben, die Menschen miteinander gemeinsam haben. Diese Eigenschaft, die Kommensurabilität und Universalisierung von moralischen Urteilen erst möglich macht, findet er in der Sympathie. Als Hinleitung und zur Verdeutlichung des Problems lässt sich dabei ein Text heranziehen, in dem Hume das Phänomen kulturvarianter Werte genauer analysiert. Der subjektivistische Charakter des moralischen Urteils ist nämlich Gegenstand der Untersuchung „Ein Dialog“ im Anhang der „Untersuchung über die Prinzipien der Moral“.
4.3.1 Sitte und Gefühl. Kulturrelativismus vs. Universalismus in „A Dialogue“
Unsere Erkenntnis orientiert sich, Humes Empirismus zufolge, notwendigerweise anhand jeweiliger individueller Erfahrungen. Daher bleibt die Frage nach der Allgemeingültigkeit des moralischen Urteils bestehen. Besonders deutlich wird dies durch den Vergleich von verschiedenen kulturell geprägten Wertmaßstäben: Ein und dieselbe Handlung kann in unterschiedlichen kulturellen Kontext unterschiedlich bewertet werden. Hume erklärt dieses Phänomen mit der Perversion des natürlichen moralischen Gefühls durch religiös-fundamentalistische Erziehung. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass auch das verstandesmäßige Erkennen durch diese Erziehung geprägt werden kann. Wenn die (mittelbare) Folge einer bestimmten Handlung in einer bestimmten Kultur häufig als wünschenswert erfahren wird, wird uns die Vernunft beide Vorstellungen auch als kausal verknüpft erscheinen lassen. Wie soll dann ein durch kulturell bedingte Erfahrungen geprägter Vernunft das moralische Gefühl korrigieren, das durch eben diese Erfahrungen pervertiert wurde?
Hume betont das Prinzip der Nützlichkeit, dass uns eine Tendenz des Handelns angibt. Um den Nutzen einer Handlung ausmachen zu können, müssen wir die gewohnheitsmäßige Erfahrung eines gleichzeitigen Auftretens von Handlung X und für das Gemeinwohl wünschenswerte Folge X‘ gemacht haben. In verschiedenen Kulturen werden allerdings je andere Verknüpfungen erfahren. Praktiken wie Speiseverbote oder Normen wie Monogamie können in der einen Kultur als dem Gemeinwohl nützlich, in der anderen jedoch als dem Gemeinwohl abträglich erfahren werden. Basiert also nicht gerade das Prinzip der Nützlichkeit auf partikularen Erfahrungen, sodass sich aus ihr kein universalistisches Moralprinzip ergeben kann?
Auf das Problem des Relativismus ethischer Urteile geht David Hume gesondert in dem Text „Ein Dialog“ ein, der in ironischer Art und Weise die Sitten und Traditionen anderer Länder und Kulturen einander gegenüberstellt. Ähnlich wie in Montesquieus Perserbriefen berichtet ein Reisender, Palamedes, einem Freund über seine Erlebnisse während seines Aufenthalts in einem fremden Land (Fourli), dessen „zivilisierte und intelligente“94 Einwohner, sich befremdlich in Hinsicht auf die Moral, gar gegensätzlich zu seinen persönlichen moralischen Ansichten, verhalten: „Die Begriffe dieses Volkes […] sind gleichermaßen außergewöhnlich in Hinsicht auf gutes Benehmen und gesellschaftlichen Umgang wie auf die Moral.“95 Das Erlernen ihrer Sprache, der Bedeutung ihrer Wörter sowie deren Zusammenhang mit Lob und Tadel war dementsprechend notwendig. Palamedes erzählt seinem Freund weiter von einem geschätzten Einwohner Fourlis, Alcheic, über den er während seines dortigen Aufenthalts einige bemerkenswerte Dinge erfuhr. So führte jener geheime Liebesverhältnisse mit jungen Männern, mit denen er seine Frau betrog, die nebenbei seine Schwester war, ermordete seinen eigenen Vater, übte ein grausames Attentat auf einen guten Freund aus, genoss es seine Mitmenschen zu verhöhnen, über sie zu scherzen und sie zu hänseln und begann letztlich Selbstmord. Für all diese Taten, so wunderte sich Palamedes, wurde Alcheic jedoch unter seinen Mitmenschen verehrt. Keine seiner Bostaten blieben verschwiegen und auch nach seinem Selbstmord wurde er für sein „tugendhaftes und edles Leben“ gepriesen.96
„Du hast doch nur Spaß gemacht. Derart barbarische und wilde Sitten sind nicht nur unvereinbar mit zivilisierten und intelligenten Menschen, wie du sie nanntest, sondern sie sind auch kaum vereinbar mit der menschlichen Natur“97,
so die Reaktion des Freundes.
„Du ahnst nicht, daß du eine Blasphemie äußerst und deine Lieblinge, die Griechen beleidigst – und besonders die Athener, die ich mit bizarren Namen benannt habe (Palamedes).“98
Im weiteren Verlauf des Dialogs werden die Sitten der Griechen und Römer einander gegenübergestellt und Parallelen zu den Einwohnern von Fourli aufgezeigt: Die Liebesverhältnisse der Griechen (Knabenliebe) und ihre Ehen (Inzest), der Tyrannenmord an Caesar durch Brutus und Cassius sowie das ironische Verhalten Sokrates gegenüber seinen Mitmenschen.99 Auf den Einwand des Freundes hin, dass die Griechen gleichfalls die Moral der modernen Gesellschaft in Frage stellen würden, wenn sie zum Beispiel von der Galanterie („die der Liebeleien und Liebschaften“) und der Schuldknechtschaft im zivilisierten Frankreich100 hören würden, kommt Palamedes zu einer wesentlichen Schlussfolgerung: „[…] weder in der Antike, noch in der Moderne kann kaum ein Volk gefunden werden, dessen nationaler Charakter im großen und ganzen weniger Anstoß erregt.“101 Und weiter: „ […] Mode, Sitte, Brauch und Gesetz [sind] das wichtigste Fundament aller moralischer Bestimmungen.“102
Die zentrale Frage, die sich im Dialog stellt ist die Frage nach dem Unterschied in den Gefühlen der Moral, der zwischen Ländern, deren Charaktere nichts gemeinsam haben, besteht. Es geht Hume (im Dialog der Figur des Palamedes) um die Suche nach den allgemeinsten Prinzipien der Moral, nach den „ersten“ Prinzipien, die jedes Land für Lob oder Tadel aufstellt. ???Frankreich England Beispiele.
Wie im Traktat lautet seine These, dass unser größtes Lob denjenigen Eigenschaften gilt, die anderen unmittelbar nützlich sind:
„Es scheint, daß jede Eigenschaft, die jemals von irgendjemandem als Tugend oder moralischer Vorzug empfohlen worden ist, nur aufgrund ihrer Nützlichkeit oder Annehmlichkeit für ihn selbst oder für andere so empfohlen worden ist.“103
Diese Eigenschaften begründen die sozialen Tugenden des Wohlwollens und der Gerechtigkeit. Das tätige Wohlwollen (benevolence) ist eine natürliche soziale Tugend. Wir schätzen eine Person, die gesellig, gutmütig, barmherzig und freundlich ist. Wir loben sie umso mehr, wenn wir davon ausgehen können, dass ihre Handlungen dem Zusammenhalt der Gesellschaft dienlich sind.
Hume zeigt durch den Dialog auf, dass die Sittenregeln einer Gesellschaft aus denselben allgemeinen Prinzipien (Nützlichkeit und Wohlwollen) heraus entspringen und lediglich die Einflussfaktoren der verschiedenen Zeiten, Traditionen, Religionen, Sprachen, Staatsformen etc. die Ursache des tatsächlichen Unterschieds im moralischen Urteil ausmachen:
„Manchmal unterscheiden sich Menschen in ihrem Urteil über die Nützlichkeit irgendeiner Gewohnheit oder Handlung. Manchmal machen auch besondere Umstände von Dingen eine moralische Eigenschaft nützlicher als andere und verleihen ihr einen besonderen Vorzug.“104
Sinnbildlich für die unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die die Menschen der Umstände halber ziehen, obwohl die Prinzipien (Nützlichkeit und Wohlwollen), auf deren Grundlage sie über Moral urteilen, dieselben sind, wird im Dialog das Bild zweier Flüsse verwendet, die in entgegensetze Richtungen fließen, sich jedoch von demselben Prinzip der Schwerkraft leiten lassen:
„Der Rhein fließt nach Norden, die Rhone nach Süden, aber beide entspringen aus demselben Berg und werden in ihren entgegensetzten Richtungen von demselben Prinzip der Schwerkraft angetrieben. Die verschiedenen Neigungen des Bodens, auf dem sie fließen, verursachen alle Unterschiede ihres Laufs.“105
So mögen auch die konkreten moralischen Sätze der einzelnen Kulturen und Zeiten voneinander verschieden sein, gar einander widersprechen (= in entgegengesetzte Richtungen fließen); ihren Ursprung haben sie jedoch alle in den universell menschlichen Prinzipien, bei der Erfahrung von etwas, was als nützlich angesehen wird, Freunde zu empfinden, sowie anderen Menschen Wohlwollen entgegenzubringen. Was aber jeweils für nützlich gilt, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten der betreffenden Gesellschaften ab, in denen die jeweilige Moral gilt.
Wie ist nun aber die Tatsache zu erklären, dass wir nicht nur das, was uns nützlich ist, als freudebringend empfinden (was wiederum unser moralisches Urteil motiviert), sondern auch das, was anderen Menschen und der gesamten Gesellschaft nützlich ist? Warum empfinden wir anderen gegenüber Wohlwollen? Diese Frage beantwortet Hume mit dem Prinzip der Sympathie.
4.3.2 Das Prinzip der Sympathie
Dem Skeptizismus verpflichtete Denker lehnen oft das Konzept einen summum bonum ab, da die Existenz universell verbindlicher Moralvorstellungen nicht festgestellt werden kann. So heißt es etwa in Thomas Hobbes‘ Elements of Law, jedermann nenne „das, was ihm gefällt und Vergnügen bereitet, gut, und das, was ihm missfällt, schlecht“ (Kapitel 7). (Chapter 7) So wie sie von unterschiedlicher körperlicher Konstitution sind, unterschieden sich die Menschen auch in ihrer Auffassung von Gut und Böse. Ein schlechthin Gutes, gebe es deshalb nicht.
David Hume nun sucht in der Anlage der menschlichen Natur ein Prinzip, dass dem moralischen Relativismus begegnen kann, denn unserer moralischen Reaktion auf Ereignisse liegen bestimmte feststehende Kriterien zugrunde. Hume fasst sie, im Anschluss an Shaftesbury und Hutcheson, unter dem Begriff moral sense106 zusammen. Ebenso wie für Hutcheson kann für Hume ein Affekt nicht unvernünftig sein, höchstens das auf ihm fußende Urteil. Auch Hutcheson ist der Auffassung, dass der Mensch eine Vielzahl von Sinnen, sowohl innerlich als auch äußerlich, reflexartig und direkt, hat, wobei die allgemeine Definition eines Sinnes „“jede Bestimmung unseres Geistes ist, Ideen unabhängig von unserem Willen aufzunehmen und Wahrnehmungen von Vergnügen und Schmerz zu haben.““107 Hutcheson spezifiziert neben den fünf allgemein anerkannten externen Sinnen das Bewusstsein, durch das jeder Mensch eine Wahrnehmung von sich selbst und von allem, was in seinem eigenen Kopf vor sich geht, hat (Metaph. Syn. pars i. cap. 2), den Sinn für Schönheit (manchmal speziell „“ein innerer Sinn““ genannt), einen öffentlichen Sinn, oder sensus communis, „“die Entschlossenheit, sich über das Glück anderer zu freuen und sich in ihrem Elend unwohl zu fühlen““, den „moralischen Sinn für Schönheit in Handlungen und Zuneigungen, durch die wir Tugend oder Laster wahrnehmen, in uns selbst oder anderen“, ein Gefühl der Ehre oder des Lobes und der Schuld, „“das die Anerkennung oder Dankbarkeit anderer zum notwendigen Anlass des Vergnügens macht, und ihre Abneigung, Verurteilung oder Abneigung gegen Verletzungen, die von uns anlässlich dieses unangenehmen Gefühls der Scham verursacht wurden“ sowie ein Gefühl des Lächerlichen.“108
David Humes moralischer Emotivismus steht nun in direkter Folge zu Francis Hutchesons moral-sense-Theorie,109 findet sein Hauptprinzip allerdings in dem Gefühl der sympathy. 110 Es ist für ihn ein unparteiisches, unvermeidliches und universelles moralisches und ästhetisches Prinzip. Eine Handlung, die verspricht, der Allgemeinheit von Nutzen zu sein, so seine Beobachtung, ruft in uns notwendigerweise das Gefühl der Zustimmung hervor.
Die Beobachtung des äußeren Ausdrucks der Zuneigung eines anderen Menschen in seiner „Haltung und Gespräch“, die Idee seiner Leidenschaft ruft in unserem Geist Mitgefühl hervor. So ist es auch mit der Beobachtung der typischen Ursache einer Leidenschaft: Zum Beispiel wird das Betrachten der für die Operation eines anderen ausgelegten Instrumente Ideen von Angst und Schmerz hervorrufen.
„Es gibt keine bemerkenswertere Eigenschaft der menschlichen Natur, sowohl an sich selbst betrachtet als auch mit Blick auf ihre Konsequenzen, als diese Neigung, die wir haben, mit anderen zu sympathisieren und durch Kommunikation ihre Neigungen und Gefühle zu empfangen, wie verschieden oder sogar wie widersprechend sie zu unseren eigenen auch sein mögen.“111
Wir haben zu jeder Zeit einen maximal lebendigen und kraftvollen Eindruck von uns selbst. Die Lebendigkeit einer Wahrnehmung wird automatisch auf die anderen übertragen, die mit ihr durch Ähnlichkeit, Kontiguität sowie Ursache und Wirkung verbunden sind. Hier stehen Ähnlichkeit und Kontiguität im Vordergrund. Alle Menschen, unabhängig von ihren Unterschieden, sind in ihrer körperlichen Struktur und in den Arten und Ursachen ihrer Leidenschaften ähnlich. Seine Ursache hat das Mitgefühl also in der Ähnlichkeit des einen Menschen zu seinem Nächsten. Die Person, die ich beobachte oder betrachte, kann mir auch in spezifischeren gemeinsamen Merkmalen wie Charakter oder Nationalität ähneln. Aufgrund der Ähnlichkeit und meiner Nähe zur beobachteten Person ist die Idee seines Empfindens in meinem Kopf mit meinem Eindruck von mir selbst verbunden, wodurch sie eine große Lebendigkeit erhält. Der einzige Unterschied zwischen einer Idee und einem Eindruck ist der Grad der Lebendigkeit oder Lebendigkeit, den jeder besitzt. Diese erworbene Lebendigkeit ist so groß, dass die Idee seines Empfindens in meinem Kopf zu einem Eindruck wird, und ich erlebe dieses Empfindens tatsächlich. Wenn ich beispielsweise einen ästhetischen Genuss beim Anblick eines schön gestalteten Schiffes oder eines fruchtbaren Feldes erlebe, das nicht mein eigenes ist, kann meine Freude also nur durch Mitgefühl verursacht worden sein. 112 Hume zeigt ebenfalls, dass, wenn wir über einen Charakter oder eine geistige Eigenschaft nachdenken, die seine Tendenz entweder zum Nutzen oder zum Vergnügen von Fremden oder zu ihrem Schaden oder ihrem Unbehagen kennt, wir Freude empfinden, wenn die Eigenschaft vorteilhaft oder angenehm für diese Fremden ist, und Unbehagen, wenn die Eigenschaft schädlich oder unangenehm für sie ist. Diese Reaktion auf die Tendenz eines Charakterzuges, die Gefühle derjenigen zu beeinflussen, mit denen wir keine besonderen liebevollen Bindungen haben, lässt sich nur durch Sympathie erklären.
Diese Ähnlichkeit, für die die Natur gesorgt hat, ermöglicht es uns daher, uns miteinander zu vergleichen, den anderen verstehen zu können und uns seine Gefühle zu eigen machen zu können. Mitgefühl verbindet uns (associates) und ist daher ein allgemein-menschliches Prinzip, durch das wir an der Gefühlswelt unserer Mitmenschen teilhaben können: „Sympathy renders all their sentiments intimately present to us.”113
Daher lässt uns deren Schicksal nicht vollkommen unbewegt. Wir schätzen das, was an einer Person dem Ziel dienlich ist, mit dem wir uns selber als mit dem Endziel unseres Wollens identifizieren können, als tugendhaft ein. Eigenschaften, die diesen Zielen entgegenstehen, halten wir für lasterhaft. Auch die Meinung der anderen sind uns wegen des Prinzips der Sympathie von Belang, z. B. ihre Wertschätzung und Freundschaft.
„Wenn alle Kräfte und Elemente der Natur sich vereinigten, um einem einzigen Menschen zu dienen und zu gehorchen, wenn die Sonne auf seinen Befehl hin aufginge und unterginge, die See und die Flüsse nach seinem Belieben fluteten und wenn die Erde ihn von sich aus mit allem versorgte, was nützlich und angenehm für ihn ist, würde er sich doch elend fühlen, bis du ihm wenigstens eine Person gibst, mit der er sein Glück teilen und an dessen Wertschätzung und Freundschaft er sich erfreuen kann.“114
Die Sympathie ist somit auch die notwendige Bedingung für viele andere unserer Gefühle, weil sie ja auf andere Menschen bezogen sind. Liebe oder Hass kann ich nur empfinden, wenn ich in dem anderen ein ähnliches Wesen erkenne, zu dem ich Mitgefühl verspüren kann.
Dabei bilden sich in mir die Empfindungen des anderen ab und rufen einen Affekt in mir hervor. Er und seine Gefühle werden Teil meines Selbst.115 Wenn sich ein Mensch über etwas Sorgen macht, kann auch ich diese Sorge nachempfinden. Und dieses Empfinden kann wiederum von ihm wahrgenommen und widergespiegelt werden. Auf diese Weise verdoppelt sich unser Gefühl; ein ursprüngliches Vergnügen an einem Glücksfall wird durch ein zweites, vermitteltes Vergnügen ergänzt, den Freund ob dieses Glücksfalls ebenfalls vergnügt zu sehen. Hume scheint beinahe die moderne Forschung von Spiegelneuronen vorwegzunehmen, wenn er schreibt:
„Wir können ganz allgemein bemerken, dass die Geister der Menschen füreinander wie Spiegel sind. Und dies nicht allein, weil sie ihre Gefühle wechselseitig reflektieren, sondern auch, weil diese Strahlen der Leidenschaften, Empfindungen und Meinungen oftmals hin- und zurückgeworfen werden und allmählich verlöschen können.“116
Das ist möglich, weil wir Ähnlichkeit und Nähe zu den anderen Menschen wahrnehmen können. Ebenso wie in der Erkenntnistheorie bei der Frage nach der Kausalität (vgl. Kap. 2.1) fungieren diese Prinzipien hier als Mechanismen der Verbindung. Je näher und je ähnlicher, so die logische Folge, desto intensiver ist das mitfühlende Nachempfinden.
Aber nicht nur das Geschick des anderen, sondern auch seine Handlungen, sein Verhalten wird uns durch das Prinzip des Mitgefühls erst zu einer moralisch bewertbaren Kategorie. Weil ich es mit meinem Verhalten in einer ähnlichen Situation vergleichen kann, kann ich auch empfinden, ob es mir Wohlwollen oder Unbehagen bereiten würde. Ohne Sympathie gäbe es also auch keine Unterscheidung zwischen Tugend und Laster. Sympathie ist die Grundlage unseres moralischen Urteils, begründet sie aber alleine noch nicht. Ermöglicht wird es durch das Gefühl der Zustimmung oder Ablehnung zu der Handlung einer anderen Person. Die Rolle der Vernunft ist hier fürs erste bloß, zwischen unterschiedlichen Handlungsweisen zu vergleichen und abzuwägen, ob eine alternative Handlung evtl. noch besser oder schlechter gewesen wäre.
Wie steht es nun um die Frage nach dem Verhältnis von ethischem Relativismus zum Emotivismus, wenn wir das bestimmende Prinzip der Sympathie mit einbeziehen?
Hume wendet sich zum einen gegen die Vorstellung, moralische Gefühle allein aus dem Prinzip der Selbstliebe erklären zu können, wie es etwa Michel de Montaigne, Thomas Hobbes und Bernard de Mandeville tun. Neben der Selbstliebe, die er gleichwohl als starkes motivierendes Gefühl anerkennt, gebe es in uns auch ein auf die Allgemeinheit gerichtetes Gefühl, aus dem Wohlwollen und Menschlichkeit entspringen. Mitgefühl ist im Gegensatz zur Selbstliebe wahrhaft altruistisch. Da nun das Mitgefühl in der Ähnlichkeit der Menschen zueinander gründet und ein im Wesen des Menschen zu findendes Gefühl darstellt, haben wir hier einen ersten „objektiveren“ Ansatz als den des ethischen Egoismus, für den Moralvorstellungen sich nur nach subjektivem Für-richtig-halten orientieren.
Das Prinzip Sympathie ist zudem universeller als das bloße Wohlwollen, von dem Hume es abgrenzt und das mit dem Grad der Distanz zu der betroffenen Person abnimmt. Mitgefühl ermöglicht uns einen allgemeinen Standpunkt, indem die Einbildungskraft die Ähnlichkeit der Menschen, und seien sie noch so fern, immer wieder vor Augen stellen kann.
„Upon these principles we may easily remove any contradiction, which may appear to be betwixt the extensive sympathy, on which our sentiments of virtue depend, and that limited generosity which I have frequently observ’d to be natural to men, and which justice and property suppose, according to the precedent reasoning. My sympathy with another may give me the sentiment of pain and disapprobation, when any object is presented, that has a tendency to give him uneasiness; tho‘ I may not be willing to sacrifice any thing of my own interest, or cross any of my passions, for his satisfaction.”117
4.3.3 Gesellschaft und Gerechtigkeit
Wie wir gesehen haben, ist für David Hume unsere Sympathie mit einem anderen Menschen ganz und gar von unserem Urteilen über die Affekte abhängig, die wir der Menschen aufgrund zuschreiben, wenn wir wahrgenommen und analysiert haben, unter welchen Umstände sie handelt.
„Kein Affekt eines anderen kommt unmittelbar zu Bewusstsein. Wir bemerken nur seine Ursachen oder Wirkungen. Aus diesen schließen wir auf den Affekt, und folglich sind es diese, die unsere Sympathie hervorbringen.“118
Unser Mitgefühl bezieht sich folglich nicht auf den Affekt, sondern auf die Wirkung des Affekts. Das Kriterium für die Beurteilung dieser Wirkung finden wir dann, wenn wir sehen, dass wir nur solche Affekte gutheißen, deren Wirkungen unsere Sympathie und Sorge gilt. Der Zweck darf uns nicht gleichgültig sein, wenn er Gegenstand unserer Billigung und Missbilligung sein soll.
Dieser Zweck ist unsere Sorge um das Wohl der Gesellschaft (concern for society)269. Humes Hauptargument, dass die Vernunft allein nicht ausreicht, um moralische Bewertungen abzugeben, hängt davon ab, dass er im gesamten Buch gezeigt hat, dass mindestens eine Grundlage des moralischen Lobes in der Nützlichkeit des erwünschten Charakterzuges für die Gesellschaft liegt. Wir nutzen die Vernunft ausgiebig, um die Auswirkungen verschiedener Eigenschaften zu erlernen und die nützlichen und schädlichen zu identifizieren. Aber Nützlichkeit und Unfähigkeit sind nur Mittel; wenn wir dem Wohl und Wehe der Menschheit gleichgültig wären, würden wir uns ebenso gleichgültig fühlen gegenüber den Merkmalen, die diese Ziele fördern. Deshalb muss es ein Gefühl geben, das uns dazu bringt, das eine dem anderen vorzuziehen. „Dieses Gefühl kann kein anderes sein als eine Sympathie mit dem Glück der Menschheit und eine Empörung über ihr Elend, da dies die verschiedenen Ziele sind, auf deren Förderung Tugend und Laster hinarbeiten.“Das kann nur die Menschheit sein, „ein Gefühl für das Glück der Menschheit und der Groll gegen ihr Elend119 „???ZIT (EPM App. 1.3). Dieses Argument setzt voraus, dass die moralischen Bewertungen, die wir vornehmen, selbst Ausdruck von Gefühlen und nicht nur von Vernunft sind. Wir loben Eigenschaften und Charaktere, die die Tendenz haben, das Interesse der Gesellschaft (interest of society) zu befördern. Dieses Prinzip erst erlaubt es, dass wir wirkliche moralische Empfindungen haben. Es ist das Prinzip der Sympathie,
„[…]das uns so weit aus uns selbst herausnimmt, dass wir dasselbe Gefühl des Vergnügens oder des Unbehagens einem Charakter gegenüber empfinden, der für eine Gesellschaft nützlich oder schädlich ist, als ob er diese Tendenz auf unseren eigenen Vorteil oder Schaden hätte.“120270
Hume erörtert die theoretische Möglichkeit, dass jemanden das Wohl und Wehe seiner Mitmenschen nicht berühren könnte.
“Stellen wir uns einen Menschen vor, der ursprünglich so veranlagt ist, dass er keine wie immer geartete Anteilnahme an seinen Mitmenschen nimmt, sondern das Glück und Elend aller fühlenden Wesen mit noch größerer Gleichgültigkeit betrachtet als zwei benachbarte Schattierungen derselben Farbe. Nehmen wir an, das Wohl der Völker Läge auf der einen Seite und ihr Ruin auf der anderen, und von ihm wäre eine Wahl verlangt; dann würde er wie der Esel des Scholastikers unschlüssig und unentschieden zwischen zwei gleichen Motiven stehen, […], ohne irgendeine Neigung oder Vorliebe für eines der beiden.“121
Ein Mensch aber ist dazu nicht in der Lage; ein solches Wesen müsste ein Ungeheuer sein. Jeder Mensch, sei er auch noch so hartherzig und egozentrisch, besitzt die Fähigkeit, ein moralisches Urteil zu fällen. Daher unterscheidet er auch zwischen dem, was nützlich, und dem, was schädlich ist. Und sogar der Verbrecher beklagt sich darüber, wenn er ungerecht behandelt wird. Hume geht also davon aus, dass die Empfindsamkeit für das Wohlergehen anderer genuin menschlich ist, wenn sie auch im konkreten Leben überlagert sein mag.
Wir billigen die künstlichen Tugenden (Gerechtigkeit in Bezug auf Eigentum, Loyalität zur Regierung und die Gesetze der Nationen und die Regeln der Bescheidenheit und der guten Sitten zu befolgen) zu jeder Zeit und an jedem Ort, auch wenn unser eigenes Interesse nicht tangiert ist. Wir billigen sie nur wegen ihrer Tendenz, der gesamten Gesellschaft dieser Zeit oder dieses Ortes zu dienen. Hume zeigt, dass „die Reflexion über die Tendenz von Charakteren und mentalen Qualitäten ausreicht, um uns das Gefühl von Anerkennung und Schuld zu vermitteln.122„. Das von der Sympathie hervorgerufene Lustgefühl ist also die moralische Bestätigung, die wir für diese Charakterzüge empfinden. Wir finden die Charakterzüge – die Ursachen – angenehm, weil sie das Mittel zum Zweck sind, das wir aus Sympathie für angenehm halten.
In dieser Ausrichtung auf die Gesellschaft und auf das, was sie fördert und was sie destabilisiert, liegt ein weiteres Moment des Univeralistischen in Humes Ethik. Hume konstatiert, dass zu allen Zeiten soziale Tugenden wie Wohltätigkeit und Großmut, Milde und Mäßigung wertgeschätzt wurden. Zugleich missbilligen wir Voreingenommenheit und Parteilichkeit, Unaufmerksamkeit und mangelndes Mitgefühl als „»bösartig, verwerflich oder verderbt“«, weil sie unser Gefühl von „»natürlicher Humanität“« (natural humanity) stören.
Dem Menschen ist das Wohl der Menschheit (the good of humankind) wesenhaft von großer Bedeutung. Dadurch vermag er einen Standpunkt einnehmen, der ihn von der ganz und gar subjektiven und eingeschränkten Sicht löst. Hume nennt diesen Standpunkt den eines „verständigen Zuschauers“ ((judicious spectator). Dieser „Richter“ urteilt so unparteiisch wie möglich. Indem er nun sein Urteil verbalisiert, um es anderen verständlich zu machen, muss er auf etwas als universell Begriffenes zurückgreifen.
„Er muß darum in diesem Falle von seiner privaten und besonderen Situation absehen und einen Standpunkt einnehmen, den er mit anderen teilt. Er muß ein universales Prinzip der menschlichen Natur ansprechen und eine Saite berühren, die in allen Menschen gleichgestimmt und harmonisch ist. Wenn er darum sagen will, daß dieser Mann Eigenschaften besitzt, deren Tendenz der Gesellschaft gefährlich ist, dann hat er einen allgemeinen Standpunkt gewählt und ein Prinzip der Humanität angerührt, mit dem jeder zu einem gewissen Grade übereinstimmt.“123
Das Universelle eröffnet sich in der Sprache und in der Mitteilung des Urteils und des eigenen moralischen Empfindens, das man als eines darstellt, das andere Menschen berechtigterweise auch haben können.
Wir sehen also von unseren eigenen direkten Interessen ab und stellen das allgemeine höher, ebenso wie wir im ästhetischen Empfinden ein interesseloses Wohlgefallen (Kant) haben können. Darin begründet sich nun auch die reflektierende und korrigierende Rolle der Vernunft im moralischen Urteil: im unparteiischen, intersubjektiven Standpunkt kommen wir zu einer Korrektur der unmittelbaren Reaktion, so wie es beim ästhetischen Geschmacksurteil ist.
„Allein wenn ein Charakter im Allgemeinen betrachtet wird, ohne Bezug auf unser partikulares Interesse, verursacht dies ein solches Gefühl oder eine solche Empfindung, aufgrund deren er als moralisch gut oder schlecht bezeichnet wird.“124
Diese Unparteilichkeit können alle Menschen einnehmen, wenn sie zu einem moralischen Urteil ihrer selbst und der anderen gelangen. Mit der Vernunft müssen wir unser moralisches Urteil immer wieder überprüfen, es gewissermaßen verfeinern. Diese Verfeinerung geschieht nach den Regeln der Gesellschaft, in der das Individuum aufgewachsen ist, und die es durch Gewohnheit gelernt hat. Auch dadurch ermöglicht sich, wenn auch keine strenge Objektivität, so doch eine intrakulturelle und intersubjektive Vergleichbarkeit moralischer Werte und Urteile.
Sympathie ist also das Grundprinzip einer zugleich interesselosen wie interessierten Form des teilnehmenden Handelns.125 Gleichwohl bleiben sie subjektivistisch. Von einem praktischen Gesichtspunkt macht es jedoch nach Hume kaum einen Unterschied, ob Tugend und Laster nun objektive Züge einer Handlung sind oder subjektive Gefühle im Betrachter: Für den Betrachter sind sie real, und er wird Verhaltens-Regularien, etwa die Gesetze eines Landes, entsprechend ausrichten. Wenn wir eine Handlung als grausam beurteilen, dann besteht unser Urteil nicht allein in dem Gefühl der Missbilligung; wir sind vielmehr davon überzeugt, dass die Handlung wirklich grausam ist. Es ist die Handlung, die wir als grausam beurteilen, nicht bloß das Gefühl, das durch sie in uns hervorgerufen wird. Die Moral, schreibt Hume, „ist etwas Reales, Wesentliches und in der Natur begründet“126. Auch dieser Aspekt hebt ihn vom moralischen Relativismus und vom bloßen Emotivismus ab.
4.4 Gewohnheit und Sympathie als „Natural operations of the mind“
Es wurde gezeigt, dass es die Aufgabe des Geistes in Humes Erkenntnistheorie ist, Ideen aus der Erfahrung, d.h. aus Eindrücken, zu verbinden und die Prinzipien zu bestimmen, nach denen diese mentale Leistung stattfindet. Indem wir dank Gewohnheit und durch Instinkt (natural operation of the mind) die Einheitlichkeit der Erlebniswelt annehmen, können wir die Vielfalt unserer Ideen und damit unserer Welt ordnen. Dies geschieht durch die Zuordnung bestimmter Ereignisse zu bestimmten anderen Ereignissen als Wirkung oder Ursache. Diese gewohnte Verbindung bezieht sich jedoch auf den Ist-Zustand, ermöglicht es uns aber auch, wahrscheinliche Aussagen über die Zukunft zu treffen. Dennoch bezieht sich diese Aktivität des Geistes nur auf das Sein. In der Moraltheorie geht es jedoch immer darum, was sein sollte, d. h. ein Bereich, der für den Geist als solchen nicht zugänglich ist (Humes Gesetz, s. o.). Hier ist, wie gezeigt, die Aktivität des menschlichen Gefühls oder die Motivation des Willens der entscheidende Faktor. Weil Hume betont, dass nur das Gefühl Ziele für den menschlichen Willen setzen und ebenso nur das Gefühl die Folgen einer Handlung als liebenswert oder hasserfüllt einschätzen kann, kann für ihn moralisches Handeln, das zwischen gut (wünschenswert) und schlecht (verbunden mit Abneigung) unterscheidet, nicht von der Vernunft geleitet werden, sondern muss das menschliche Gefühl als Führer erkennen. Da der Mensch jedoch viele Gefühlszustände kennt, aber nicht alle von ihnen moralisch sind, ist es offensichtlich, dass moralische und amoralische Gefühle unterschieden werden müssen. Im Folgenden werden wir fragen, welche Rolle der Geist bei der Unterscheidung zwischen moralischen und amoralischen Gefühlen spielt. Es sind mehrere Aspekte zu unterscheiden.
Zunächst ist zu beachten, dass in Hume das Gefühl selbst und damit auch das moralische Gefühl aus der Aktivität des Geistes stammt. Wie dargestellt, unterscheidet Hume zwischen dem Eindruck von Empfindungen und dem Eindruck von Reflexionen. Diese zweite Kategorie, als Spiegel des Geistes, stellt die emotionalen Erfahrungen von Gefühlen (sentiments) dar. Das bedeutet, dass das moralische Gefühl bereits von einer Aktivität des Geistes begleitet wird. Wenn moralisches Handeln durch die Bewertung der Folgen einer Handlung gekennzeichnet ist, stellt sich die Frage, inwieweit sich das Gefühl der Güte oder Menschlichkeit von dem der Selbstliebe unterscheiden lässt. Laut Hume ist das moralische Gefühl die treibende Kraft aller moralischen Handlungen sowie der Fall des letzten Gerichts, aber aus dem gleichen Grund kann dies auch für egoistische Gefühle gesagt werden.
Hier hat der Geist nun eine zweite Funktion. Wie gezeigt, erfüllt er diese Funktion auf drei Arten: Der Geist stellt uns die Folgen einer Handlung vor, d.h. er beinhaltet auch die Nebenwirkungen, die vom moralischen Gefühl im Allgemeinen ignoriert werden. Das Gefühl der Güte gegenüber einem anderen Menschen reicht in der Regel aus, um die Freude dieses Menschen zu erhöhen oder sein Leiden durch Handeln zu verringern. Das bedeutet, dass weitere Konsequenzen nur von der Vernunft erkannt werden können, der dann in einem zweiten Schritt zum Gefühl im Sinne einer moralischen Bewertung präsentiert wird. Dieser Schritt wird von der Vernunft mit Hilfe der Verknüpfung von Ideen unternommen, indem er eine bestimmte Handlung als Ursache für einen bestimmten Nutzen oder Schaden versteht. Der Mensch kann daher nur dann moralisch handeln, wenn seine Vernunft ihn die Vorteile seines Handelns als Folge seines Handelns verstehen lässt. Dies geschieht, wie gezeigt, durch die gewohnte Verknüpfung von Ideen.
Zweitens muss die Vernunft die individuellen, erwarteten oder möglichen Folgen einer Handlung abwägen. Da nicht jede Konsequenz mit der gleichen Wahrscheinlichkeit eintrifft, ist es für moralisches Handeln wichtig, dass mehr wahrscheinliche Konsequenzen berücksichtigt werden. Auch diese Aktivität kann das moralische Gefühl nicht hervorrufen. Das moralische Gefühl schreibt jeder einzelnen dargestellten Konsequenz einer Handlung die gleiche Stärke der Zuneigung oder Abneigung zu, unabhängig von der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens. Dabei greift die Vernunft auf Erfahrungen zurück: Je öfter eine bestimmte Episode in der Vergangenheit aufgetreten ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um eine bestimmte Episode handelt. Der dritte Schritt wird von der Vernunft gemacht, um das moralische Gefühl von dem unmoralischen zu unterscheiden. Altruistische Gefühle, wie z.B. Mitgefühl, können von egoistischen Gefühlen, wie z.B. Selbstliebe, unterschieden werden, indem die Vernunft die beiden in einem Moment der Reflexion rational ausgleicht. Dies verhindert, dass der Mensch sich einfach von den intensivsten seiner Gefühle leiten lässt, was ihn im Prinzip unfrei machen würde. Durch die Betonung der Rolle der Vernunft im Prozess des moralischen Urteilens entgeht Hume zudem dem Problem, dass der Wille des Menschen, würde er sich rein vom moralischen Gefühl leiten lassen, unfrei wäre.
Zuletzt reflektieren wir die unterschiedlichen Einflüsse auf unser Gefühl. Obwohl der Ursprung der moralischen Gefühle der Menschen in einer uns allen gemeinsamen, menschlichen Natur liegt, finden wir doch Unterschiede in unserem moralischen Handeln. Dies ist auf dreierlei Weise zu erklären: Zum einen damit´, dass die Individuen ihren je eigenen egoistischen Neigungen unterschiedliche Bewertungen zusprechen. Ob ein Mensch eher seinen Ruf in der Gesellschaft verbessern will oder einen unmittelbaren Lustgewinn erzielen will, ist von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Zudem schränken wir den Kreis derer, auf die sich unser moralisches Gefühl bezieht, unterschiedlich stark ein. Der eine bevorzugt Familie und Freunde im Vergleich zu Fremden stärker als der andere. Und schließlich hat auch die Erziehung einen divergierenden Einfluss auf das moralische Urteil. Eine strenge religiöse Erziehung z. B. kann unser moralisches Gefühl pervertieren, indem es uns Folgen, die unserem natürlichen, moralischen Gefühl hassenswert erscheinen, als neutral oder sogar liebenswert erscheinen lässt.
Es gibt also einen Kern gemeinsamer moralischer Gefühle unter den Menschen, der durch verschiedene lebensweltliche Einflüsse überdeckt werden kann. Der Vernunft kommt nun die Aufgabe zu, die unterschiedlichen Einflüsse zu reflektierten, wodurch er die Unvoreingenommenheit des moralischen Gefühls ermöglicht. Dies geschieht vor allem durch interpersonalen und -kulturellen Vergleich und Kommunikation.
Inwiefern findet nun die natural operation of the mind auf der Verstandesebene ein Pendant auf Ebene des moralischen Urteilens? Gibt es eine natürliche und unvermeidliche natural operation of the mind im moralischen Gefühl? Natürlich wäre eine Operation des Geistes zu nennen, wenn sie unvermeidlich auftritt. In Humes Erkenntnistheorie kommt diese Eigenschaft wie gesehen der Gewohnheit zu: Die Vernunft verknüpft bestimmte aus der Erfahrung gewonnene Vorstellungen gewohnheitsmäßig. Wir können nicht anders, als häufig, nacheinander auftretende Ereignisse so zu verknüpfen, dass wir ihnen Kausalität unterstellen.
Notwendige Voraussetzung für moralisches Handeln ist nun also die Sympathie. Während im Bereich des menschlichen Erkennens die Gewohnheit dasjenige verstandesmäßige Prinzip, das uns praktisches Handeln insofern ermöglicht, als aus ihm die Erkenntnis einer geordneten und konsistenten Erfahrungswelt entspringt, ermöglicht das auf Ähnlichkeit beruhende Mitgefühl Moralität, weil es in uns Affekte verursacht, die auf Lust bzw. Unlust beruhen. Durch Gewohnheit erkennen wir die nötigen Mittel zur Erreichung eines Zwecks, indem sie notwendige Vorstellung von Kausalität herstellt. Allerdings bezieht sich moralisches Handeln nicht auf die Mittel, sondern immer auch und vor allem auf den Zweck. Die Bewertung eines Zwecks kann nun, wie gezeigt, nur das Gefühl vornehmen, wie es auch das Gefühl ist, das uns dazu motiviert, das wünschenswerte Ziel anzustreben.
Beide Prinzipien treten in uns also natürlich und unvermeidlich auf und ermöglichen Erkenntnis sowie (moralisches) Handeln. Auf den ersten Blick nun scheinen sowohl Gewohnheit als auch Mitgefühl als Prinzipien nicht weiter analysierbar zu sein. Das Mitgefühl kann unser Handeln anleiten, indem es uns eine bestimmte Folge als wünschbar oder zu vermeiden erscheinen lässt. Nach welcher inneren Logik das Mitgefühl jedoch vorgeht, ist uns nicht unmittelbar verständlich. Hume unternimmt nun, ebenso wie in seiner Erkenntnistheorie, die Aufgabe das Prinzip dieser nNatural operation of the mind zu untersuchen.
Es zeigt sich, dass das Mitgefühl nach drei Prinzipien Vorstellungen miteinander verknüpft, die denen der bei der Gewohnheit fungierenden äquivalent sind. Diese Äquivalenz ist, soweit ich sehe, von Hume selber nicht expliziert worden. Sie wird aber deutlich, wenn man die drei Prinzipien der gewohnheitsmäßigen Vorstellungsverknüpfung mit den drei oben genannten Prinzipien des Mitgefühls vergleicht.
Zum einen verknüpft unsere Vernunft zwei Vorstellungen nach dem Prinzip Ursache-Wirkung. Unser Gefühl auf der anderen Seite verbindet gewohnheitsmäßig eine einzelne Tat mit ihrer Folge und diversen Nebenfolgen, auf die wir mit Lust bzw. Unlust reagieren. Zum zweiten erkennt unsere Vernunft zwei Vorstellungen als einander zugehörig an, wenn sie einander ähnlich sind. Dementsprechend empfinden wir für diejenigen Objekte, die uns ähnlich sind, Mitgefühl. Daher nennt Hume das Gefühl des Wohlwollens auch Menschlichkeit (humanity): Weil es sich aus der Erfahrung der Ähnlichkeit zu anderen Menschen bildet. Auch Tieren gegenüber können wir zwar Mitgefühl empfinden, umso stärker, je ähnlicher sie uns sind. Aber letztlich wird uns ein Mensch mehr Möglichkeit zu Mitgefühl bieten. Als drittes verbindet die Vernunft Vorstellungen nach dem Prinzip zeitlicher bzw. räumlicher Nähe. Und auch das Mitgefühl für einen Menschen ist nach Hume umso stärker, je näher uns der Mensch ist. Dieses Prinzip stellt eine perspektivierende Beschränkung des menschlichen Mitgefühls und damit des moralischen Urteils dar, da wir offenbar nicht für jeden Menschen das gleiche Verbundenheitsgefühl aufbringen können. Das stellt einen gewissen Konflikt dar, denn auf der einen Seite können Gefühle des Mitgefühls abhängend von der räumlichen und zeitlichen Entfernung vom Bewertungsobjekt variieren, auf der anderen Seite müssen das rein moralische Bewertungen nicht tun; Hume beantwortet diesen Einwand mit der relativierenden Funktion der Vernunft beim moralischen Urteil.
Wir beobachten also eine frappante Parallelität der beiden nNatural operations of the mind auf der Sein- bzw. Sollenebene. Diese könnte daraus zu erklären sein, dass, wie oben erwähnt, das moralische Gefühl der Verstandestätigkeit (iImpression of reflexions) entspringt, und zum anderen daraus, dass der Vernunftschluss für Hume ein ruhiger sekundärer Affekt ist, ein „kleines Gefühl“.127 In der Parallelität zwischen den natürlichen und unvermeidlichen Prinzipien zeigt sich also ein innerer Zusammenhang der Hume‘schen Epistemologie und der Hume‘schen Metaethik.
Es steht die Frage aus, inwiefern die drei Prinzipien der Vorstellungsverknüpfung einen universellen Charakter haben könnten. Da ihre Wirkung vor allem einschränkender Natur ist, ist unklar, ob sie überindividuelle moralische Werte angeben können. Das Prinzip von Ursache- Wirkung wählt unter der prinzipiell unendlichen Anzahl von möglichen Handlungen diejenigen aus, deren Folgen als wünschenswert erscheinen. Das Prinzip der Ähnlichkeit beschränkt das moralische Urteil weitestgehend auf menschliche Subjekte. Dem Prinzip der Kontiguität / Nähe kommt perspektivierende Bedeutung zu. Dadurch könnte jedem Individuum eine andere Handlung bzw. Folge als wünschenswert und damit moralisch gut erscheinen, je nach individueller Vorerfahrung (Erziehung, Kultur). Will man aber eine universalistische Ethik etablieren, muss nach dem verbindenden Prinzip der Moral gefragt werden. Hume nun beantwortet diese Frage mit der These, dass das moralische Gefühl einer uns allen gemeinsamen menschlichen Natur entspringt, während er der Vernunft die Rolle des Korrektors zu, der uns unvoreingenommen macht und etwaige Verzerrungen unseres Mitgefühls erkennbar macht und ausgleicht.
Es fragt sich, ob das Prinzip der Sympathie ein rein qualitatives oder auch ein quantitatives Merkmal von Moral sein kann. Wenn bei Hume das Mitgefühl die Grundlage des moralischen Urteils ist, bedeutet das dann, dass ein Mehr an Mitgefühl das moralische Urteil „besser“ macht? Ist das Urteil eines Menschen, der prinzipiell mehr Mitgefühl empfindet ein moralischeres Urteil als dasjenige eines Menschen, der entweder per se weniger Mitgefühl aufbringt oder sein Mitgefühl durch beschränkende Operationen des Geistes (rationales Abwägen) bewusst verringert?128 Die Entwicklungen in der Psychologie haben hervorgehoben, dass es zwischen Individuen und auch zwischen Gruppen erhebliche Unterscheide in Bezug auf das Mitgefühl gibt. Bestimmte Formen von Soziopathie, aber auch von Autismus, werfen die Frage auf, ob Betroffene nicht oder nur mangelhaft moralisch urteilen können. Verschiedene Studien der Genderforschung legen nahe, dass es in dieser Hinsicht auch geschlechterspezifische Differenzen gibt. Ließe sich daraus folgern, dass das moralische Urteil von Männern prinzipiell weniger zutreffend ist als das von Frauen?
Schluss
Es wurde gezeigt, dass Humes Empirismus der Vernunft im Bereich der Erkenntnis einen untergeordneten Stellenwert einräumt, während sich aus der Erfahrung die Grundbausteine für unser Erkennen bilden. Die Prinzipien, mit denen diese Bausteine ineinandergreifen und komplexes Wissen ermöglichen, hat Hume mit Blick auf allgemeinmenschliche Mechanismen analysiert. Dabei erhält vor allem das Prinzip der Kausalität eine Neubewertung. Humes Skeptizismus führt ihn dazu, in der Kausalität das Werk der Gewohnheit und den Glauben an die Gleichförmigkeit der Natur zu sehen, weswegen allgemeingültige Induktionsschlüsse nicht möglich und Erfahrungswissenschaften vor einem großen epistemologischen Problem stehen.
Das Reich der Gefühle wird von Hume extensiv systematisiert und, wie schon im Bereich der Erfahrung, auf seine Grundbausteine zurückgeführt und mit Assoziationsregeln verbunden. Durch die Betonung der wichtigen Rolle des Gefühls gelangt Hume zu einer Neubewertung der Frage nach der Herkunft des moralichen Urteils; er erblickt sie, mit Hutcheson und Shaftesbury, im Gefühl, ohne jedoch einen eigenständigen moral sense anzunehmen. Gut und Böse sind für uns Wirkungen, die aus den Reaktionen unseres Gefühls (wohlwollend oder missbilligend) auf unmittelbar beobachtete Handlungen, auf ihre angenommenen Folgen sowie auf die Motivation des Handelnden herrühren. Diese Theorie erklärt auch, warum wir überhaupt zu moralischem Handeln motiviert werden; die Vernunft alleine ist dazu nicht in der Lage.
Dem Problem des moralischen Relativismus, das sich aus dem Subjektivismus der Gefühlsethik ergibt, begegnet Hume mit der Betonung des allgemeinmenschlichen Prinzips der Nützlichkeit. Dieses wird dank dem Wohlwollen, das wir aufgrund der Ähnlichkeit der Menschen untereinander mitfühlend (sympathy) empfinden, auf unsere Mitmenschen, auf die Gesellschaft oder gar die ganze Menschheit übertragen und erweitert, sodass Hume auch hier dem Vorwurf des ethischen Egoismus entkommen kann.
Der Konnex zwischen Erkenntnistheorie und Gefühlsethik wurde abschließend anhand der Parallelität der Strukturen und Assoziationsregeln, die Hume jeweils der Gewohnheit sowie der Sympathie zuspricht, aufgezeigt. Es ist daraus ersichtlich geworden, dass Humes Analyse der menschlichen Erkenntnis und die des moralischen Urteils ein zusammenhängendes Ganzes ergeben, das einerseits zwar die Rolle der Vernunft skeptizistisch beschränkt, andererseits aber Erfahrung und Gefühl als Führerinnen bestimmt, anhand derer sich für das praktische Zusammenleben der Menschen auch in verschiedenen Gesellschaften und Kulturen verallgemeinerbare moralische Grundsätze ausfindig machen lassen.
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Hume, David: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Hrsg. von H. Herring. Stuttgart 2018. (zit. als UMV)
Hume, David: An Enquiry concerning the principles of morals. Hrsg. von Tom L. Beauchamp. Oxford 1998.
Hume, David: Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral. Hrsg. von G. Streminger. Stuttgart 2012. (zit. als UPM)
Hume, David: Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral. Hrsg. von M. Kühn. Hamburg 2003.
Hume, David: Traktat über die menschliche Natur. Hrsg. von R. Brandt. Hamburg, Band I 1978, Band II 1989. (zit. als TMN I, II)
Hume, David: Ein Abriß eines neuen Buches, betitelt: Ein Traktat über die menschliche Natur, etc. (1740). Brief eines Edelmannes an seinen Freund in Edinburgh (1745), Hrsg.: J. Kuhlenkampff. Hamburg 1980.
Sekundärliteratur
Bachmann-Medick, D. (1989): Affektübertragung und »extensives Mitgefühl«: Sympathie bei David Hume. In: Die Ästhetische Ordnung des Handelns. Stuttgart 1989. S.244-271.
Bloom, Paul: Against Empathy: The Case for rational compassion. New York 2016.
Fieser, I.: Hume’s Classification of the Passions and Its Precursors. In: Hume Studies XVIII/I (1992), S. 1-17.
Fenner, Dagmar: Ethik auf Grundlage von Gefühl oder Vernunft? Zur Rolle moralischer Gefühle bei Hume und Kant. Basel 2009, S. 146-179.
Gräfrath, Bernd: Moral Sense und praktische Vernunft. David Humes Ethik und Rechtsphilosophie. Stuttgart 1991.
Gräfrath, Bernd: David Humes säkularer Humanismus: Zur Aktualität seiner naturalistischen Ethik. In: Aufklärung und Kritik. Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie. Hrsg. von der Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg, 1/2011, S. 63-72.
Hutcheson, Francis: An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections with Illustrations on the Moral Sense. Hrsg. von Aaron Garrett. Indianapolis 2002.
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Jens Timmermann. Hamburg 1998.
Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften [Akademieausgabe]. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1900 ff..
Locke, John: Versuch über den menschlichen Verstand. Band I: Buch I und II. Hrsg. von R. Brandt. Hamburg 2006.
Kemp Smith, Norman: The Philosophy of David Hume: A Critical Study of its Origins and Central Doctrines. Basingstoke 1941.
Klemme, Heiner F.: David Hume. Zur Einführung. Hamburg 2007.
Kulenkampff, Jens: David Hume. München: Beck 1989.
Leibniz, Gottfried Wilhelm: Monadologie und andere metaphysische Schriften: Discours de métaphysique; Monadologie; Principes de la nature et de la grace fondès en raison. Hrsg. von U. Schneider, Hamburg 2002.
Lohmar, Dieter (1997): Die Idee einer reflektierten Gefühlsmoral. Ein Beitrag der Gefühlsethik des britischen Empirismus (Shaftesbury, Hutcheson, Hume) zur interkulturellen Perspektive der Aufklärung. In: Schneider, N.; Lohmar, D.; u.a. (Hrsg.): Philosophie aus interkultureller Sicht. Philosophy from an intercultural perspective. Amsterdam, S. 121-160.
Steinfath, Holmer: Emotionen, Werte und Moral. In: Döring, S. A./ Mayer, V. (Hrsg.), Die Moralität der Gefühle, DZP, Berlin 2002, S. 105-124.
Streminger, Gerhard: David Hume. Der Philosoph und sein Zeitalter. München 2011.
Streminger, Gerhard: Hume. Sein Leben und sein Werk. Paderborn 1994.
Streminger, Gerhard: Die Vernunft ist die Sklavin der Leidenschaften und soll es sein (David Hume). In: Aufklärung und Kritik 3/ 2011, S. 50-53.
Winters, B.: Hume on Reason. Hume Studies 5, 1979, S. 20-35.
Zauner, Franz: Erkenntnis-Freiheit-Religion. David Humes Religionskritik. Wien/Berlin 2011.
1 Hume gebraucht den Begriff „reason“ nicht immer in durchgehend eindeutiger Weise, sodass er für die deutsche Übersetzung schwer vom Begriff „Verstand“ zu unterscheiden ist. Im Traktat bezeichnet er die Vernunft als „die Erkenntnis von Wahrheit und Irrtum“ (Buch III, S. 198). Für unsere Zwecke sei hier und im Weiteren der Eindeutigkeit wegen der Begriff „Vernunft“ verwendet. Zu Humes unterschiedlichem Gebrauch des Begriffs „reason“, s. B. Winters: Hume on Reason, Hume Studies 5, 1979, S. 20-35.
2 Vgl. Hume, Untersuchung über den menschlichen Verstand (im Folgenden: UMV), S. 32.
3 Ebd., S. 31.
4 Hume, UMV, S. 34.
5 John Locke: Versuch über den menschlichen Verstand, 2006, Buch II, Kap. 1, § 2.
6 Hume, UMV, S. 35.
7 Vgl. Hume, UMV, S. 24.
8 Hume, Ein Abriß eines neuen Buches, betitelt: Ein Traktat über die menschliche Natur, 1980, S.18.
9 Hume, UMV, S. 49f.
10 Hume, Ein Abriß eines neuen Buches, betitelt: Ein Traktat über die menschliche Natur, 1980, S. 25.
11 Immanuel Kant, Gesammelte Schriften [Akademieausgabe], Berlin 1900 ff., Bd. IV, S. 259.
12 Vgl. Leibniz, Monadologie §33.
13 Hume, UMV, S. 58.
14 Ebd., S. 102.
15 Ebd., S. 63.
16 Vgl. ebd., S. 65.
17 Vgl. Hume, UMV, S. 67.
18 Ebd. S. 64.
19 Kemp Smith, Norman: The Philosophy of David Hume, S. 392.
20 Hume, UMV, S. 70.
21 Ebd., S. 71.
22 Vgl. ebd.
23 Hume, Traktat über die menschliche Natur (im Folgenden: TMN), S.69.
24 Hume, UMV, S. 94.
25 Hume, UMV, S. 99.
26 Ebd., S. 100.
27Vgl. Hume, UMV, S. 76.
28 Streminger 2011, S. 274.
29 Vgl. Hume, TMN, S. 74.
30 Hume, TMN, S. 139.
31 Hume, UMV, S. 63.
32 Kant, KrV, B232.
33 Vgl. Hume, TMN, S. 103.
34 Ebd., S. 197.
35 Zu unterscheiden ist in dieser Hinsicht natürlich die Frage nach dem Tier als Objekt moralischer Urteile und Handlungen, im Gegensatz zum Status als Subjekt oder Agenten von Moral. Hume betont hier die Fähigkeit der Tiere, Lust und Leid zu empfinden, die sie uns in dieser Hinsicht ähnlich macht, und spricht in diesem Zusammenhang von „fellow-creatures“. Unser Mitgefühl dehnt sich auch auf den Bereich aller empfindender Wesen („sensible beings“) aus, wir können deren Wohl und Wehe mitfühlen, sodass auch Tiere Objekte moralischer Betrachtung sind. Hume orientiert sich hier an Benthams: „ […] the question is not, Can they reason? Nor, Can they talk? But, Can they suffer?” (s. Bentham, An Introducion to the Principles of Morals and Legislation. London 1789, S. 235.)
36 Hume unterteilt, wie gezeigt, Eindrücke (impressions) bereits in seinem ersten Buch (TMN I) in innere und äußere Wahrnehmungen. Unter äußeren Wahrnehmungen versteht Hume, das, was gesehen, gehört, gerochen oder ertastet werden kann.
37 Vgl. Steinfath, 2002, S. 119.
38 Hume, TMN, S. 437.
39 Vgl. Hume TMN, S. 3 u. S. 103.
40 Vgl I. Fieser, Hume’s Classification of the Passions and Its Precursors, in: Hume Studies XVIII/I (1992), S. 1-17.
41 Vgl. Hume, TMN, S. 4.
42 Ebd. S. 177.
43 Ebd., S. 511.
44 Vgl. Hume, TMN, S. 5.
45 Hume, zitiert nach Klemme, 2007, S. 196 u. TMN, S. 439.
46 Hume, TMN, S. 5.
47 Fenner, 2009, S. 150.
48 Hume, TMN, S. 5.
49 Hume, TMN, S. 16.
50 Hume, TMN, S. 354; vgl. S. 317 (“the idea, or rather the impression of ourselves”).
51 Hume, TMN, S. 338.
52 Hume, zitiert nach Streminger (TMN, II, S.155).
53 Hume, TMN, S. 338.
54 Ebd., S. 512.
55 Ebd. 276.
56 Ebd., S. 176.
57 Hume, zitiert nach Klemme, 2007, S. 130.
58 Kühn, 2003, S. 15.
59 Vgl. Gräfrath, B., 1991, S.7ff.
60 Hume, zitiert nach Beauchamp, 1998, S. 11.
61 Hume, TMN, S. 153.
62 Vgl. Hume, TMN, 150f.
63 Vgl. Lohmar, 1994, S.131.
64 Hume, TMN, S. 380.
65 Hume, UPM, S. 11.
66 Ebd., S. 155 f.
67 Vgl. Hume, TMN, S. 357.
68 Hume, TMN, S. 337.
69 Hume, TMN, S. 357.
70 Gräfrath, 2011, S. 66.
71 Hume, TMN, S. 572.
72 Hume, zitiert nach Zauner, 2011, S. 109.
73 Hume, zitiert nach Streminger, 2011, S. 53.
74 TMN, S. 540.
75 Hume, UPM, S. 293.
76 Hume, TMN, S. 487. David Hume: Ein
77 Ebd..
78 Gräfrath, 2011, S. 63.
79 Hume, UPM, S. 159.
80 Vgl. Lohmar, 1994, S. 131.
81 Streminger, 2011, S. 173.: David Hume : der Philosoph und sein Zeitalter. Beck, München 2011, S
82 Ebd., S. 167.
83 Vgl. Lohmar, 1994, S. 131.
84 Hume, UPM, S. 158.
85 Vgl. Lohmar, 1997, S. 132.
86 Vgl. Hume, UPM, S. 159.
87 Vgl. Lohmar 1997, S. 132.
88 Vgl. ebd.
89 Vgl. Hume, UPM, S. 215 f.
90 Vgl. Hume, TMN, S.575.
91 Vgl. Hume, UPM, S. 91.
92 Hume, TMN, S. 211 f.
93 Hume, TMN, S. 469.
94 Hume, zitiert nach Kuhlenkampff, 1989, S. 165.
95 Ebd., S. 168.
96 Vgl. Hume, zitiert nach Kuhlenkampff, 1989, S. 168.
97 Ebd., S. 169.
98 Ebd.
99Vgl. ebd., S. 170.
100 Vgl. ebd. S. 181.
101 Ebd., S. 174.
102 Ebd.
103 Vgl. Hume, zitiert nach Kuhlenkampff, 1989, S. 178.
104 Ebd.
105 Ebd., S. 175.
106 Hume, TMN, S. 581.
107 Hutcheson: (Essay on the Nature and Conduct of the Passions, Abschnitt 1.
108 Vgl. dazu J. Sprute:, Der Begriff des Moral Sense bei Shaftesbury und Hutcheson, in: Kant-Studien 71. 1980, S.221–237, S.225.
109 Vgl. ebd.
110 Erneut stellt uns ein Hume’scher Begriff vor übersetzerische Schwierigkeiten. Es ist darunter im Treatise kein bloßes Mitleid und auch kein Wohlwollen (wie im zweiten Enquiry, wo er ihn fast gleichbedeutend mit benevolence verwendet) zu verstehen. Der moderne Terminus Empathie wäre ebenfalls eine mögliche Übersetzung. Mitgefühl ist nicht direkt Wohlwollen, aber doch eine gewisse Sorge um das Wohlergehen anderer. Mitleid hingegen ist ein spezieller Fall von sympathy, der vom Anblick des bemitleideten Objekts abhänge. Es entstehe aufgrund der menschlichen Fähigkeit zu Sympathie. Es handele sich dabei um ein Gefühl, das eine gewisse Nähe voraussetze und ein zu großes Maß an Distanz nicht vertrage. David Hume: Ein Traktat über die menschliche Natur, Buch II, übersetzt v. Theodor Lipps u. hrsg. v. Konrad Blumenstock, Darmstadt 1967, S. 49; vgl. Chr. Demmerling, H. Landweer: Philosophie der Gefühle. Von Achtung bis Zorn. J.B. Metzler, Stuttgart, Weimar 2007, S. 104f.
111 Hume, zitiert nach Klemme, 2007, S. 104.
112 Hume, TMN, S.348.
113 Hume, zitiert nach Gräfrath, B., 1991, S. 82.
114 Hume, zitiert nach Klemme, 2007, S.104.
115 Hume, TMN, S.320.
116 Hume, TMN, S.365.
117 Hume, zitiert nach Gräfrath, 1991, S. 82.
118 Hume zitiert nach Klemme, H.F., 2007, S. 136.
119 Hume, UPM, S. 150.
120 Hume, zitiert nach Klemme, 2007, S. 153.
121 Hume, UPM, S. 87.
122 Vgl. Klemme, 2007, S. 152.
123 Hume, UPM, S. 133.
124 Hume, zitiert nach Klemme, H.F., 2007, S. 154.
125 Vgl. Bachmann-Medick, 1989, S. 245.
126 Hume, TMN, S.296.
127 Hume, zitiert nach Klemme, 2007, S. 130.
128 Vgl. Bloom, 2016, S. 84.